- HOME
- START
- NACHRICHTEN
- Glaube, Liebe, Hoffnung
- Weltalphabetisierungstag in Neunkirchen: Scham überwinden, Freude an Buchstaben entdecken
- Was benötigen Menschen im Hunsrück?
- Exit Einsamkeit: „Nacht gegen die Einsamkeit“ und Doku
- Jugend- und Gästehaus Bistum Trier ist offiziell eröffnet: Tür und Herz stehen offen
- Shana towa – Glückwünsche zum neuen jüdischen Jahr
- „Kirche in Not“ gibt modernisierte Version der Kinderbibel heraus
- Menschen begegnen – Oasen beleben!
- Verhärtungen überwinden, Türen öffnen
- Karl Kübel Preis an Familie Tekkal: Ein starkes Signal für Familie als Basis gesellschaftlichen Zusammenhalts
- „Weihnachten Weltweit“ – Hilfswerke laden zur ökumenischen Kita-Aktion ein
- Früh darüber reden
- Entscheider tauchen in das Leben anderer ein
- Vertretungspriester: „Die deutsche Kirche ist stark“
- Deutschlands erstes „Achtsamkeits-Pilger-Journal“ ist Wegbegleiter, Inspirationsquelle und Reflexionsraum auf der Reise zu sich selbst!
- Sankt Martin 2025: Neues Aktionsmaterial des Kindermissionswerks zum Martinsfest ab sofort erhältlich
- 100 Jahre Salesianer Don Boscos auf Helenenberg
- Welttag der Suizidprävention: Reden kann retten
- Versteckte Kleinode im Rampenlicht
- Gut gefüllter Terminkalender
- Hospiz will Heimat für alle Menschen sein
- Welttag der Suizidprävention am 10. September: „Erstmals ist Suizid die häufigste Todesursache bei jungen Menschen“
- Profanierung in Calmesweiler: Abschied von St. Pius X. in Trauer und Dankbarkeit
- Angebote der Ferienkirche weiterhin verfügbar : Marienburg: Kirche in Bewegung
- Am 7. Oktober: „Kirche in Not“ lädt ein zu „Eine Million Kinder beten den Rosenkranz“
- Übersicht rettet Leben
- Bistum Trier legt Leitfaden für Betroffene von sexualisierter Gewalt vor: Möglichkeiten der individuellen Aufarbeitung
- Am 14. September: Augsburger Gebets- und Solidaritätstag für Christen in Nigeria
- Erster Seliger für Estland
- Vortrag in Koblenz mit ehemaliger Staatsministerin zog fast 100 Personen an : Religion und Demokratie
- ADAC Stiftung unterstützt Schulen im Saarland bei Reanimationsunterricht
- Bistum Trier eröffnet Schöpfungszeit 2025 mit einem Thementag zu ‚Laudato Sí‘: Ein starkes Dokument
- Dr. Marianne Schröter tritt ihr Amt als neue Direktorin der Franckeschen Stiftungen an
- "Pfarrei der Woche" von Radio Horeb: Pfarrei Heilig Geist in Losheim am See live im Rundfunk
- Begegnung im Pfarrgarten
- Kirchen (wieder) aufbauen
- Mit dem eigenen Vermächtnis Kindern eine bessere Zukunft schenken
- Jubiläumsprogramm der AG Gemeinsam Gedenken Gestalten geht weiter: Jüdisches Leben in Schweich und Umgebung soll nicht in Vergessenheit geraten
- Herberge auf Zeit
- Ein Kunstwerk mit vielen Rätseln
- Bistum Trier: Citypastorales Angebot in Saarbrücken Innenstadt endet: Farewell im „welt:raum“
- Aus aller Welt
- RiC TV und SOS-Kinderdörfer weltweit zum Weltkindertag: Kindern eine Stimme geben - Geschichten voller Hoffnung aus aller Welt
- Deutscher Umweltpreis für Prof. Seneviratne und ZINQ
- Entrepreneurs Day: Die bewegende Geschichte von Collins Anenbo und der Kraft unternehmerischer Bildung
- Schwangere Frauen erhalten in Delhi Hilfe bei extremer Hitze
- Mord an Priester erschüttert Sierra Leone
- Gründer der Hilfsorganisation Global Micro Initiative e.V. besucht Hilfsprojekte und prüft Standorterweiterung in Indonesien
- Peru: Unkontaktierte Mashco Piro erneut durch Abholzung in ihrem Gebiet gefährdet
- Humanitäre Lage im Sudan spitzt sich dramatisch zu
- Gaza: Hungersnot offiziell bestätigt
- „Kirche in Not“ sichert weltweit Schulbildung von Tausenden Kindern und Jugendlichen
- Pakistan: Zwei Jahre nach christenfeindlichen Ausschreitungen gibt es immer noch keine Gerechtigkeit
- Entrepreneurs Day: Die bewegende Geschichte von Collins Anenbo und der Kraft unternehmerischer Bildung
- „Kirche in Not“ (ACN) stellt im Oktober neuen Bericht zur Religionsfreiheit vor
- Angriffe auf humanitäre Helfer innerhalb von zwei Jahren mehr als verdoppelt
- Kinderschutz kennt keine Grenzen - SOS-Kinderdörfer weltweit und ISPCAN vereint für globale Standards
- Ukraine: „Die zerstörerischste Waffe ist das Gefühl, vergessen zu sein“
- Jugendliche haben weltweit immer schlechtere Berufschancen
- Von Islamisten entführter Priester in Nigeria: „Ich war in ständiger Todesangst“
- Kasachstan: „Kirche in Not“ unterstützt Ausstellung über das „Turiner Grabtuch“
- Finnland: Eine wachsende Kirche
- Bessere Berufschancen für 23.000 Jugendliche dank der Initiative "YouthCan!" der SOS-Kinderdörfer
- Kultur
- Vorfreude auf «Yayoi Kusama» und letzte Tage «Vija Celmins» in der Fondation Beyeler
- Das erste jüdische Museum der Welt wird 130 Jahre alt
- Künstliche Intelligenz als moralischer Dialogpartner
- THE WEEKND verlängert rekordbrechende Stadiontour After Hours Til Dawn
- SYSTEM OF A DOWN: 2026 AUF STADIONTOUR IN EUROPA UND UK
- Ars Electronica 2025 verzeichnet über 122.000 Besuche
- TYLER CHILDERS: Im Frühjahr mit On The Road: EU & UK Tour 2026 für exklusive Deutschlandshow in Berlin
- Full Proof Bakery meets Alle Farben Kitchen: Pop-Up Event auf Mallorca
- TILL BRÖNNER kündigt "Italia - Die Tournee 2026" an | Album-VÖ: 05.09.25
- Ukrainian Film Festival Berlin 2025 eröffnet mit “Songs of Slow Burning Earth”
- „Das bin ich“ – Alena Neubert zeigt ihre ganze musikalische Seele im Fortuna Theater
- Ab 4. September mit Empfehlung der FBW-Jugend Filmjury im Kino: TAFITI - AB DURCH DIE WÜSTE
- Cirque du Soleil kommt 2026 mit Alegría auch nach Düsseldorf
- Saale-Unstrut: Klosterschätze entdecken
- Historische Schulbibliotheken im Dialog zwischen Bibliotheken, Schulen und Forschung
- DEF LEPPARD: Im Sommer 2026 in UK und Europa auf Tour
- Prix Ars Electronica Ausstellung 2025
- Alle Farben live beim Festival of Lights in Concert 2025 im Berliner Dom
- Out Now! DEEP PURPLEs vergessenes Meisterwerk "Rapture Of The Deep" feiert 20 Jahre mit neuem Mix und unveröffentlichten Tracks
- Fotoausstellung Faszination Zollverein bis 2. November 2025 verlängert
- HALSEY: Back To Badlands
- Schauspielerin Iris Berben: Die Linke hat „wichtige ureigene Themen vernachlässigt“
- The Bros. Landreth: erste Single „I’ll Drive” aus dem neuen Album "Dog Ear", featuring Bonnie Raitt und Begonia
- SWR Streaming-Tipps für September 2025
- 50 Jahre Yps: Kult-Magazin zurück im Doppelpack - mit Retro-Charme und Popkultur!
- Ab Donnerstag mit Empfehlung der FBW-Jugend Filmjury im Kino: DIE GANGSTER GANG 2 / Neu im Home-Entertainment mit Prädikat: GOTTESKINDER und MOON, DER PANDA
- ARD CrimeTime: Lady Kalaschnikow – Die Drücker-Mafia aus dem Westerwald
- Von Superhelden, Fußballderbys und einer legendären Kaiserin – das neue Ausstellungsprogramm des Historischen Museums der Pfalz
- Eine Reise durch 24 Jahre oriental Metal: MYRATH mit erstem Greatest-Hits-Album "Reflections"
- „Shut Up, Bitch!“ – ARD Story über Frauenhass im Netz
- LAURA COX: neues Album "Trouble Coming" präsentiert kraftvolle Verbindung von Classic-Rock und modernem Sound | Album-VÖ: 31.10.25
- Meister aller Register: 20 Jahre Domorganist Andreas Sieling – Jubiläumskonzert im Berliner Dom
- „Bau eine Burg für die Gräfin“ - ARD startet erstes Roblox-Spiel zur Gamescom 2025
- European Elvis Festival 2025
- Ab Donnerstag mit Empfehlung der FBW-Jugend Filmjury im Kino: Der fesselnde Neo-Western: BITTER GOLD
- Porträt eines Allrounders: „Helge Schneider – The Klimperclown“
- Die deutsche Koproduktion WHITE SNAIL gewinnt zwei Preise in Locarno
- RUSSELL DICKERSON VERÖFFENTLICHT TITELTRACK „FAMOUS BACK HOME“ – JETZT VERFÜGBAR
- Bad Omens – US-amerikanische Metalcore-Durchstarter Ende 2025 mit starkem Support auf Tour
- Alle Farben released den Festivaltrack des Sommers auf Tomorrowland Music!
- SWR Kultur Podcast „Der römische Traum – Eine Anno-Story“
- “WELCOME TO THE HOLLER” MIT SPEZIALGAST WYATT FLORES
- „Ein Sommer in Sommerby“: Abenteuer an der Schlei
- „Lehrerin mit Herz und Hoffnung“: Jeder Schüler hat Stärken
- Aus dem Kiez ins Studio: Berliner Rapper Laszlo veröffentlicht "Moabit"
- Vom Plattenbau ins Penthouse: Warner Music Künstler ADRIAN veröffentlicht neue Single!
- TILL BRÖNNER veröffentlicht neue Single "Via con me" feat. Mario Biondi | Album-VÖ: 05.09.25
- Europapremiere in Berlin: Mit VR durch das legendäre Machu Picchu
- Ab 7. August mit Prädikat im Kino: MILCH INS FEUER
- RUSSELL DICKERSON HEIZT DEN SOMMER MIT SEINEM NEUEN HIT „WORTH YOUR WILD” EIN
- Historisch und viral: Deutschlands beliebteste Schlösser und Burgen im Social-Media-Ranking
- Kronberg Festival 2025 – Good Vibrations erleben!
- DRONEART SHOW feiert Berlin-Premiere in den Gärten der Welt
- TILL BRÖNNER kündigt neues Album ITALIA an
- ARE YOU READY FOR IT? - Taylor Swift erobert Madame Tussauds – 13 neue Wachsfiguren weltweit
- Weltpremiere in Venedig für SWR Serienkoproduktion „Etty“
- Ab Donnerstag mit Prädikat im Kino: THE LIFE OF CHUCK / Die FBW-Jugend Filmjury empfiehlt GRAND PRIX OF EUROPE / Neu im Home-Entertainment: HELDIN
- Hollywood-Flair in Heuchelheim: Alena Neubert bringt den Glanz der Filmmetropole ins Fortuna Theater
- State of the ART(ist) 2025: Hauptpreis für Café Kuba von David Shongo
- BUSH veröffentlichen zehntes Studioalbum "I Beat Loneliness"
- Gregor Meyle ist Top-Act der Landesgartenschau Neuss 2026
- LAURA COX präsentiert ihre neue Single "Trouble Coming" - ein Moment im Auge des Sturms | Single-VÖ: 17.07.25
- RUSSELL DICKERSON STELLT ERSTMALS DAS MUSIKVIDEO ZU "HAPPEN TO ME" AUF CMT VOR, BEVOR ES AUF YOUTUBE ONLINE GEHT
- Kinostart CHECKER TOBI 3 - Die heimliche Herrscherin der Erde, ab 8. Januar 2026 bundesweit im Kino
- Kick It Like Women - Talente und Träume im Frauenfußball
- Kunstmuseum St.Gallen: Neu in der Sammlung!
- Chris de Burgh legt nach zwei Ausverkauft-Tourneen 2024 mit Best Of-Konzerten ‘25 nach – inklusive neuer Songs und Coverversionen
- SOMBR: Der 20-jährige Newcomer kommt im Frühjahr 2026 nach Deutschland und in die Schweiz
- XAVIER NAIDOO gibt sieben weitere Konzerte
- Max McNown Holt Country-Folk Künstler Cameron Whitcomb Für Emotionale Strophe Zur Neuen Version Von 'Night Diving' An Bord
- „Es geschah auf unserem Grund“: Drei Frauen und ein belastendes Erbe
- Magie am Nachthimmel: Die DroneArt Show kommt nach München
- Französische. Kinoüberraschung: DIE GUTEN UND DIE BESSEREN TAGE, Kinostart: 31.7.2025
- MDR-Reihe „exactly“ zum Thema: „Alltagsdroge Alkohol“
- Prix Ars Electronica 2025: Vier Goldene Nicas vergeben
- Alle Farben ab sofort bei Virgin Records / Universal Music: Erfolgs-DJ & Producer wechselt Label
- Xavier Naidoo live mit Band - Einziges Konzert 2025 in Köln
- Bad Gastein: 15. Ausgabe der sommer.frische.kunst. ist eröffnet
- „Kick It Like Women – Talente und Träume im Frauenfußball“
- SELIG voller Spielfreude auf dem Hessentag
- Politik
- Kinderrechte ins Grundgesetz – psychologische Forschung untermauert Notwendigkeit zur Umsetzung der ratifizierten UN-Kinderrechtskonvention
- Bundesbeauftragte gegen sexuellen Missbrauch fordert verpflichtende Schutzkonzepte für Jugendreisen
- Dr. Susanne Eggert (JFF München) in Expertenkommission der Bundesregierung berufen
- Offener Brief an den Bundesfinanzminister: Sondervermögen Infrastruktur – Warum die Gesundheits- und Sozialwirtschaft jetzt zum Zuge kommen muss
- Kinder stärken. Per Gesetz? - Das SachsenSofa zu Kinderechten im Grundgesetz
- Erfahrungsaustausch zu KAB-Initiative „Faires Paket":KAB Trier im Gespräch mit Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder
- Offenheit und Bekenntnis: Wie Kirche heute die Demokratie stärken kann
- Schutz von Helfenden ist Grundlage für humanitäre Hilfe
- Hass im Netz: NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) fordert Umdenken der Justiz
- Umsteuern jetzt! Brot für die Welt fordert mehr Mut statt Kürzungspolitik
- Die Initiative „3. Oktober – Deutschland singt und klingt“ feiert am 30.07.2025 den Tag der Freundschaft
- Sozialer Wohnungsbau: Der Wohnungsmarkt steht unter großem Druck
- Veröffentlichung der Dokumentation der Internationalen Wochen gegen Rassismus 2025
- Gesetzesentwurf zum Wehrdienst: Ist die Freiwilligkeit ernst gemeint?
- SOS-Kinderdorf: „Therapie? Frag doch deine Eltern!“
- ADAC Stiftung kooperiert mit Nordrhein-Westfalen bei landesweiter Einführung von Reanimationsunterricht in Schulen
- Initiative „3. Oktober – Deutschland singt und klingt“ – Noch 100 Tage bis zum deutschlandweiten Singen am 3. Oktober 2025
- Gerechtigkeit im Bildungssystem? - Das SchulSachsenSofa zur Schulpolitik am 16. Juni in Großenhain
- Tag der Organspende: Junge Helden e.V. fordert Neustart der Debatte zur Widerspruchsregelung
- 85 Prozent der Menschen leben in Ländern mit stark eingeschränkter Zivilgesellschaft
- Rohstoffgerechtigkeit in Bolivien, Ecuador und Kolumbien – Chancen für Konflikttransformation?
- Familie als Lernort der Demokratie
- Halle (Saale), Zwickau, Erfurt: "In Echt? – Virtuelle Begegnung mit NS-Zeitzeug:innen" auf bundesweiter Tour
- Evangelische Allianz in Deutschland zum Jahrestag des Kriegsendes und der Schoa
- Verantwortung übernehmen: Kinderrechte ins Zentrum der Politik rücken!
- Wohlfahrtsverbände warnen: Einsamkeit gefährdet sozialen Zusammenhalt
- Akademie lobt Preis für Initiativen gegen Hass im Netz aus
- Tobi Krell – Wege aus dem Hass
- Saarländische Landesregierung trifft Bistumsleitungen Speyer und Trier: Land und Kirche als starke Partner
- „Mitbestimmen statt zuschauen: Demokratie in die Hand nehmen!”
- Erfolg und Kontroverse: Film und Podcast über Boris Palmer
- Evangelische Akademie Bad Boll: "Wir stehen für eine demokratische, offene und gerechte Gesellschaft" – Stellungnahme zur Bundestagswahl 2025
- Apotheker rufen zur Wahl auf: Mit "What's Apo" über Gesundheitspolitik vor Ort informieren!
- Position des Familienbundes der Katholiken im Bistum Trier zur Bundestagswahl 2025
- « Zusammenhalt in unserer Gesellschaft stärken »
- Evangelische Akademie Bad Boll: Christsein und Politik
- Schulen als Orte der Demokratiebildung: Haltung zeigen statt Neutralität
- KDFB begrüßt Verabschiedung des Gewalthilfegesetzes
- Podcast „Durchgefallen – Wie Schule uns als Gesellschaft spaltet“
- Digital und analog gegen Rassismus
- Stellungnahme der beiden Kirchen zum Zustrom-Begrenzungsgesetz (Einbringung der CDU im Deutschen Bundestag)
- Statement: Lanna Idriss, Vorständin der SOS-Kinderdörfer weltweit, fordert anlässlich der Bundestagswahl 2025, Kinderrechte ins Zentrum der Politik zu rücken
- „Mit Herz und Verstand“
- Deine Stimme für Gleichberechtigung und Demokratie – Bundestagswahl 2025
- Betzdorfer Pfadfinder planen Lichterspaziergang am 15. Januar :Zeichen für Menschlichkeit
- 108 Sternsingerinnen und Sternsinger im Bundeskanzleramt
- Brot statt Böller: Gemeinsam gegen Hunger in der Welt
- Abt Nikodemus Schnabel: „Nicht den Politikern nachplappern, sondern auf Christus hören“
- BDKJ startet Demokratieoffensive „Generation jetzt!“
- ABDA formuliert Kernpositionen zur Bundestagswahl 2025
- Ein starkes Signal für Demokratie und Nachhaltigkeit: Global Goals Klavier Nr. 16 im Deutschen Bundestag eingeweiht
- Jugendliche entwickeln Ideen für eine gerechtere Welt
- MP Schweitzer: „Den aktuellen Herausforderungen gemeinsam begegnen“ :Rheinland-Pfalz: Ministerrat trifft katholische Bischöfe
- Integrationsministerin besucht Psychosoziales Zentrum für Flüchtlinge der Caritas: „Von unschätzbarem Wert"
- Augustinus Forum: Trump ist zurück – Was bedeutet das für die USA und die Welt?
- Ministerpräsident Boris Rhein würdigt Engagement der Kirchen
- Frauenpower in der Politik
- Statement: Lanna Idriss, Vorständin der SOS-Kinderdörfer weltweit, mahnt nach dem Ende der Ampelkoalition, die Rechte der Kinder nicht aus den Augen zu verlieren
- 22.11.2024: Förderpreisverleihung „Verein(t) für gute Kita und Schule"
- Das youpaN fordert zusammen mit über 170 Organisationen: Bildung für nachhaltige Entwicklung zukunftsgerecht finanzieren
- MDR-Reihe „exactly“ zum Thema: „Keine Wohnung, keine Hilfe – Wie Maxim kämpft und der Staat versagt“
- Junger Dokumentarfilm 2024: Vom Leben und Umgang mit Krisen Ausstrahlung ab 7.11.2024
- Anpassungsindex von Brot für die Welt belegt wachsende Ungerechtigkeit bei Klimafinanzierung
- Der Trump-Einflüsterer
- Deutscher Apothekertag beschließt Resolution "Mehr Apotheke wagen"
- Initiative „3. Oktober – Deutschland singt und klingt“: Bundesweiter Schreibwettbewerb „Die Freiheit, die ich meine…“ geht in die dritte Runde
- Freiheit, Frieden, Hoffnung und Einheit! Zehntausende singen zum Tag der Deutschen Einheit
- Mit TikTok zu mehr Wertebildung: Die Werte-Stiftung und DigitalSchoolStory starten Offensive zu stärkeren Schulgemeinschaften
- Bürgerkirche St. Gangolf: Talk mit Ackermann und Asselborn
- „Schreib die Welt nicht ab. Schreib sie um!“
- KOLPING: Tariftreue stärkt Tarifpartnerschaft
- Jetzt erst recht: Demokratie verteidigen - Stellungnahme von BAG K+R und ASF zu den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen
- #JungUndLaut: Euer Engagement ist preisverdächtig! - SOS-Kinderdörfer weltweit rufen zur Abstimmung für die Preise BANGER und HÄNGER auf
- Aktuell und inklusiv: MDR macht alle Wahlsendungen für Menschen mit Sinnesbehinderung barrierefrei
- Deutschland singt und klingt: Musik überwindet Mauern. Das Paneuropäische Picknick veränderte die Welt
- Wirtschaft
- Rummelsberger Dienste werden gemeinnützige Aktiengesellschaft
- OEKO-TEX® stärkt Engagement für den Schutz der Biodiversität
- Ein Klick, alle Lösungen: Transgourmet bündelt Branchen-Expertise bei „food@service“
- Deutscher Apothekertag: Apotheken warnen vor weiteren Schließungen - Ministerin Warken verspricht Reformen
- Bürodrucker: Kampf gegen Elektroschrott und Wegwerfmentalität
- Hit the Road: Garner by IHG präsentiert die ultimative Roadtrip-Route durch Deutschland, erstellt von Carolin Niemczyk und Elena Carrière
- Roadmovie „Kraftfahrzeug – Eine deutsche Liebe“
- Monteverdi. Schweizer Automobilgeschichte zum Greifen nah im Grand Resort Bad Ragaz
- Transgourmet lädt ein zu seinen Local Hero Days
- Francke-Buch GmbH übernimmt 11 Filialen der ALPHA Buchhandlung GmbH
- Nachhaltiger Naturkautschuk: GNF veröffentlicht Factsheet mit Handlungsempfehlungen für Unternehmen
- 25 Jahre Pflicht zur Grundpreis-Angabe: Hohenheimer Studie trug zur Einführung im Einzelhandel bei
- Leidenschaft für Milch & Innovationen: Bester Azubi des Landes kommt von der Universität Hohenheim
- Chris Kaiser von Click A Tree für GreenMonarch Personality Award 2025 nominiert - Zehn Menschen, eine Mission: Eine lebenswerte Zukunft gestalten
- Jugendherbergswerk Bayern: Daniel Sautter neuer Vorstand
- Thermenträume und Zweifel: Lied aus Oberhessen wirft kritischen Blick auf Investorenprojekte
- Auch betriebswirtschaftliche Planung ist eine Frage der Nachhaltigkeit
- Apothekenzahl sinkt weiter
- Finnland: Zufriedene Menschen als Wirtschaftsmotor
- Preis zum BGH-Urteil: Rabatte und Boni gehören nicht in die Arzneimittel- und Gesundheitsversorgung
- „Deutschlands Spar-Champion 2025“ in der Kategorie PKV für Beamte: Debeka erhält Auszeichnung
- Share The Wind – Join The Crew startet soziale Initiative
- Preis: Geplantes Gesetz zu Medizinalcannabis würde den Verbraucherschutz stärken
- EB-Nachhaltigkeitspreis: Evangelische Bank beteiligt Öffentlichkeit bei Auswahl besonders nachhaltiger Initiativen
- Die meisten Testamentsspender sind keine Millionäre
- Revolutionäre Technologie-Transfers bestimmen das Finale des Deutschen Gründerpreises 2025
- Krankenhausreform: Kommunikation ist Schlüssel zum Erfolg
- Pax-Bank für Kirche und Caritas eG gibt erfolgreich vollzogene Fusion bekannt
- Zugvögel, Esskastanien, Hirschbrunft und Braukunst: Den Herbst in Deutschland barrierefrei genießen
- Trotz Konjunkturflaute: Engpässe bei Ingenieur- und IT-Fachkräften bleiben – Steigerung des Frauenanteils ein Schlüssel zur Fachkräftesicherung
- Gründungswoche Deutschland erhält Compass Award und ist Global Entrepreneurship Week Champion
- Evangelische Bank thematisiert Fachkräftemangel und fordert gerechtere Verteilung öffentlicher Finanzmittel
- Wirksame Vorsorge gegen Überschuldung
- „WIR IM NETZ – Kultur und Glaube Aktuell“ – Ihr Schaufenster für positive Beispiele
- Illegale Tricks auf dem Mietmarkt: „Vollbild“-Recherche deckt auf
- Sorgenfreie Rente im Ausland: So gelingt ein entspannter Ruhestand außerhalb Deutschlands
- TARGOBANK Stiftung ruft Förderrunde zum Thema "Planetary Health" aus
- Netto inspiriert mit neuer Kampagne für mehr Zusammenhalt in der Gesellschaft
- INSIDE CARLTON CANNES, EIN REGENT HOTEL
- ramp.space mit vier Grand Awards bei den ASTRID Awards 2025 ausgezeichnet
- Gesundheits- und Sozialwirtschaft muss auf dem Weg zur Klimaneutralität unterstützt werden
- Postbank verliert erneut Rechtsstreit zum Pfändungsschutzkonto
- Rüstung ist notwendig, aber nicht nachhaltig
- Well-Aging statt Anti-Aging
- Wird Schokolade zum Luxusgut?
- Bürokratische Entlastungen in der Pflegehilfsmittel-Versorgung für Apotheken und ihre Patienten
- 10 Millionen Euro für Niedersachsens Schulen: Besseres Lernen durch Investition in LED-Umrüstung
- Amtszeitbegrenzung und mehr Durchlässigkeit: Bundestag braucht dringend mehr Unternehmer!
- Ein besonderer Botschafter verlässt die Klinik Hohe Mark
- Interim Manager: Bauwirtschaft wird unterschätzt
- „Fachkräftemangel ist hausgemacht“: Wie Deutschland qualifizierte Zuwanderer systematisch vergrault
- Erste Degustation der Wein- und Sektprämierung Saale-Unstrut 2025
- 477 ehrenamtliche Klimaschutzpaten setzen 888 Projekte um
- Wirtschafts-Akademie warnt vor KI-Roboterwelle
- 55. Gebietsweinkönigin für die Saale-Unstrut Weinregion gesucht
- Evangelische Bank hält AAA-Rating für Hypothekenpfandbriefe
- Werte statt Geld: Immer mehr Deutsche wollen mit ihrem Erbe Gutes tun
- Klaus Tschira Stiftung stellt Fördermanagement neu auf
- Evangelische Bank schreibt 10-jährige Erfolgsgeschichte mit Höchstwerten bei Kundenvolumen und Betriebsergebnis fort
- Virale Kampagne von ROSSMANN: 200.000 Euro gegen Armut und Vereinsamung von Senioren
- Altkleider sind kein Abfall: Deutsche Kleiderstiftung ruft zu bewusster Spende auf
- Deutscher Spendenmonitor 2024: Erkenntnisse und Empfehlungen für das Bildungsengagement
- Techniker Krankenkasse unterstützt „DELPHIN-Therapie“ für stotternde Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
- Evangelische Bank stellt im Jahr 2024 mehr als 667.000 Euro für soziale Projekte bereit
- Besserer Schutz vor Stromsperren
- Bundestagswahl: Parteien wollen Apotheken stärken, Honorierung angehen und Leistungen ausbauen
- Freiwilligentag: Mehr als 840 Mitarbeitende der TARGOBANK unterstützten 2024 über 230 gemeinnützige Organisationen
- ROSSMANN spendet Waren im Wert von rund 3 Millionen Euro an die Tafeln
- Deutscher Fundraising Preis 2025: Herausragende Fundraising-Projekte gesucht!
- stromee und iDM Wärmepumpen kooperieren für nachhaltige Heizlösungen
- BBT-Gruppe eröffnet Jubiläumsjahr „175 Jahre Barmherzige Brüder von Maria-Hilf“
- Evangelische Bank lobt EB-Nachhaltigkeitspreis 2025 aus: Gemeinsam Brücken bauen für eine nachhaltige Zukunft
- Transgourmet übernimmt Deutschlandgeschäft von PIER 7
- Thomas Preis ist neuer ABDA-Präsident und setzt Priorität auf Apothekenstärkung
- Pilgerverlag vertreibt ab sofort das Buchprogramm des „Verlagshaus Speyer“
- Bundestagswahl: Initiative "What's Apo" wirft Licht auf Gesundheitspolitik
- Jetzt für den Dietmar Heeg Medienpreis bewerben!
- „Innehalten“ – Urlaub für die Seele in Baden-Württemberg
- Zuzahlungsbefreiung für 2025 beantragen
- Nachhaltig für den Erhalt der Wirtschaftsleistung - Thorsten Luber erhält Auszeichnung für sein Engagement
- Zertifizierte Nachhaltigkeit für Arnstorfer Unternehmen
- 99 Prozent BIO – 100 Prozent Leidenschaft in Oberstdorf
- Start-Up-Hilfe: Uni Hohenheim veröffentlicht Handbuch für Gründer:innen
- Monumente des Fortschritts: Brandenburgs erstaunlichste Industriekulturorte entdecken
- Flexibler Ökostrom im Trend: stromee zieht positive Bilanz bei 30- bis 50-Jährigen und Stadtbewohnern
- ZKL beschließt Empfehlungen: Landwirtschaft der Zukunft braucht Nachhaltigkeit
- Verbraucherrechte und -pflichten: Was sich im neuen Jahr ändert
- Paketankündigung zu ihrer Sendung …
- Sozial- und Gesundheitsmanager:innen fordern neue Wege bei der Finanzierung der nachhaltigen Transformation
- Veranstaltungsbranche im Fokus - Sonderpreis für Labor Tempelhof beim 17. Deutscher Nachhaltigkeitspreis
- Sustainable Finance Award 2024: Auszeichnung für herausragende wissenschaftliche Arbeiten im Bereich nachhaltige Finanzen
- Auszeichnung für neues Austernkonzept
- 32 BIO-Zertifikate in Bronze für bayerische Jugendherbergen
- Apothekenzahl sinkt immer schneller auf 17.187
- 12. MDR-Spitzentreffen mit Behindertenverbänden: MDR baut barrierefreie Angebote im Digitalen aus – Verbände fordern auskömmliche Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
- Neuer Kreis gibt Kraftfahrern im nördlichen Rheinland-Pfalz eine Stimme: Menschenwürde gilt auch am Arbeitsplatz
- Deutscher Apothekerverband sucht innovative Apothekenprojekte
- Gemeinschaftsaktion von Christlicher Erwachsenenbildung, Aktion Arbeit im Bistum Trier und Jobcenter Merzig-Wadern:„Digi4all”: Digitale Schulungen für Jobcenter-Kunden
- Forderung an die EU-Kommission: Europa muss Kapital für soziale Investitionen mobilisieren
- Deutscher Apothekertag: Ein Jahr vor der Bundestagswahl - Apothekerschaft richtet eindringlichen Appell an die Bundesregierung
- Barrierefreies Reisen: Romantische Plätze für die Winterauszeit
- Gestern bei «Die Höhle der Löwen» (VOX) - Heute Gänsehaut für Jochen Schweizer im Palacios Podcast
- stromee führt neuen Tarif für nachhaltige Wärmestromnutzung ein
- AIV lobt Schinkel-Wettbewerb 2025 aus: „Clever aufgegleist!“
- Glaube, Liebe, Hoffnung
- JOURNAL
- KULTUR
- GET TO KNOW: tubi
- FAUN – „HEX“: Zwischen den Welten der Mythen und Magie
- Verlosung auf WIR IM NETZ: Drei CDs „Gedankenspiel“ von Stefan Zauner & Petra Manuela zu gewinnen
- GET TO KNOW: LASZLO
- „Du bist mehr wert, als du glaubst“ – Sina Anastasia mit neuer Single und großer Botschaft
- Mrs. Greenbird mit neuer Single und Tourplänen – Support für Fury in the Slaughterhouse
- GET TO KNOW: Michael Kraemer
- Vom schönsten Platz Österreichs zu kulturellen Meilensteinen
- GET TO KNOW: Ben Hoffmann
- GET TO KNOW: ADRIAN
- GET TO KNOW: Thomas Lambrich
- „Deutschland schreibt ein Lied der Einheit“
- Die 8. Schweizer Autobiographie-Awards sind vergeben
- Podcast „Kopfsalat“: Einsamkeit und Schreiben
- Bio-basierte Brücke als Musikinstrument
- Wie ein Chor die Clubkultur revolutioniert: SPIELHAGEN im Interview
- Maeckes über Identität, Ehrlichkeit und seinen Umgang mit Weltschmerz - Der Musiker im Freunde fürs Leben Bar-Talk
- GET TO KNOW: Hier Kommt Nina
- GET TO KNOW: NAIR
- GET TO KNOW: Tonnen von Hall
- Für Metalheads und Fans von Hard Rock -„66,6 Metal Stories“
- Warum ein Papst die Rockmusik erfunden hat
- Garfunkel & Garfunkel "Father And Son" (TELAMO)
- King of Waltz. Queen of Music: 200 Jahre Johann Strauss in Wien
- Nina Chuba über persönliche Krisen, Therapie und Rückhalt im FRND-Bar-Talk
- Fondation Beyeler Ausstellungsprogramm 2025: Nordlichter, Träume und Unendlichkeit
- GET TO KNOW: Marla Glen
- Eine Reise durch Emotionen, Selbstfindung und tiefe Klänge: MAIVEN im Interview
- Andreas Gabalier: Mit Gaudi und G´fühl
- Roland Kaiser. Kleine Anekdoten aus dem Leben der Schlagerlegende
- Max Giesinger über Höhenflüge, Selbstzweifel und seine Therapieerfolge
- GET TO KNOW: SPIELHAGEN
- Das Schreiben und seine therapeutische Wirkung
- Marina Buzunashvilli - DIE BOSSIN
- GET TO KNOW: MAIVEN
- GET TO KNOW: Accaoui
- Adele: Über eine Popikone
- Schönherz & Fleer präsentieren das POESIE PROJEKT „Was ist Liebe“
- Festungen, Schlösser, Klöster: Barrierefreie Kulturentdeckungen im Herbst
- GET TO KNOW: CHIIARA
- Podcast „Kopfsalat“: Musik – ich singe, also spinn ich. Nicht.
- GET TO KNOW: Sina Phillips
- Segelschiffe, Entdeckertouren und Open-Air-Kultur: Barrierefreie Städtetrips im Sommer
- Rom Erleben - Reiseführer für Jugendliche
- GET TO KNOW: DANA
- GET TO KNOW: ARTEMIDES
- Hollywood-Musik made in Germany: Filmkomponist Steffen Thum im Interview
- Kinostart mit Prädikat und Empfehlung der FBW-Jugend Filmjury
- GET TO KNOW: CHRIST
- GET TO KNOW: JOSH BREAKS
- RAY – Triennale der Fotografie | Erste ECHOES Künstler*innen
- Bundesweiter Anmeldestart für Schulen: Buchgeschenke zum Welttag des Buches 2024
- Die Geschichte des Jazz als Entdeckungsreise: "Jazz und Spiritualität" von Uwe Steinmetz
- Highway Desperado", das 11. STUDIO-Album des preisgekrönten Entertainers JASON ALDEAN, ist am 03.November erschienen
- „Der Start verlief anders als geplant“ - Debütalbum von PINA BERLIN wird am 10. November veröffentlicht
- Kinostarts am 26. Oktober 2023
- Spotlight in der Dauerausstellung des Germanischen Nationalmuseums 24. Oktober 2023 bis 21. Januar 2024
- STERNE ZUM DESSERT ab 28. Dezember 2023 im Kino
- Vor fünf Jahren: Gnade spricht Gott - Amen mein Colt
- Musik, Social Media und eine gesunde Beziehung: Joelina erzählt
- Lebensgeschichte, Liebe, Schmerz und Musik: Michael Kraemer im Interview
- Mrs. Greenbird: Das neue Album "Love you to the Bone" erscheint am 8. April
- Kinostarts
- GLAUBE, LIEBE, HOFFNUNG
- Lebensmut trotz(t) Demenz: Sarah Straub mit inspirierenden Geschichten aus der Praxis
- Die Kunst des achtsamen Miteinanders
- Podcast „Kopfsalat“: Coaching
- Surf & Soul: Geist trifft Gischt
- Kardinal Anders Arborelius (Stockholm) im Interview: „Nichts unversucht lassen, die Migranten zu integrieren
- Einsamkeit, Mobbing und Staffelresümee – Podcast „Kopfsalat“
- Neapels verborgenes Licht – Hoffnung im Viertel Sanità
- Podcast „Kopfsalat“: Einsamkeit und Behinderung
- Wie Religionsunterricht Zusammenleben fördern kann
- Gott und die Schönheit
- Zum Heiligen Jahr 2025: »Alle Wege führen nach Rom« von ANDREAS ENGLISCH
- Mit Tod und Trauer umgehen und leben: "Den Schmerz umarmen"
- Künstliche Intelligenz ist eine Provokation für den Glauben | 3 Fragen an KI-Experten Michael Brendel
- Der Tod der alten Dame
- Pilgern in Vorarlberg
- Helena Steinhaus und Sabine Werth über Einsamkeit und Armut – Podcast „Kopfsalat“
- David: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen
- Vom Glauben abgefallen
- Kinostar bringt “Bonhoeffer" in die Kinos
- Mit Kindern die geheimnisvollen Rauhnächte erleben
- Raum für kleine Rituale und große Erinnerungen: Weihnachten in den SOS-Dorfgemeinschaften
- „Gott habe ihm gesagt, er solle mich zur Frau machen“ - Missbrauch in der Evangelischen Kirche – eine Einzelfallstudie
- Im Gespräch: Ein großer Auftritt dank Kardinal Lehmann
- Sport: ein starker Player für die Gesellschaft? - 5 erhellende Perspektiven
- Viele Steine bilden einen Weg
- Begeisterung - Die Kraft, die alles möglich macht
- Verzicht und Freiheit – Überlebensräume Zukunft
- Mehr als Beileid. So können wir Trauernde in schweren Zeiten begleiten
- Im Sturm lernt das Herz fliegen
- Tobias Haberl: Unter Heiden. Warum ich trotzdem Christ bleibe
- Michael Haspel: "Wer nicht liebt, steht vor dem Nichts!"
- "I still care" von Franziska Böhler
- Hadley Vlahos: Zwischen den Welten
- Rohrberger Kinder und Jugendliche lernen Franz und Klara von Assisi kennen
- Leben mit Demenz - Begleiten ohne Burnout
- Die Veredelung der Zeit
- „Laut gedacht“ mit Musiker Luvre47 – jetzt auf frnd.tv
- „Mehr als ein Job“ - Acht Frauen und Männer berichten von ihren Erfahrungen als Mitarbeitende der Diözese Würzburg
- Podcast „Kopfsalat“: Sara Doorsoun und Dr. Sharon Brehm über Liebeskummer
- Von der Symbolkraft des Wassers - Bilder und Geschichten zu Wassersegen und Brunnenbau
- Lukas Klaschinski über Gefühlsbereitschaft, das Spüren von Wut und emotionale Erfüllung
- Hat Kirche Zukunft?
- Martin Luther King. EIN LEBEN
- Ohne dich. Wenn Männer trauern
- Der Dom zu Speyer
- Mein Mann, der Alzheimer, die Konventionen und ich: »LÜCKENLEBEN« von Katrin Seyfert
- Quizbuch Bibel: Das meistgelesene Buch der Welt steckt voller Überraschungen
- Von der Reformation zur modernen Elitenherrschaft: Oliver Zimmers "Prediger der Wahrheit"
- Warum ist der Buddha so dick?
- Königlich! In Würde leben
- Vom Himmel berührt. Das Vaterunser als Übung der Achtsamkeit
- Entfeindet euch! - Auswege aus Spaltung und Gewalt
- Reich wie Buddha
- Zur Fußball-EM: Pfarrer Rainer M. Schießler erzählt seine schönsten Geschichten vom "Heiligen Rasen
- Podcast „Kopfsalat“: Erste Schritte zur Hilfe
- Der Fließweg - Interreligiös-christliche Gedanken zum Daodejing des Laozi
- Der Blick hinter den Horizont
- Und das soll man glauben? - WARUM ICH DER BIBEL TROTZDEM VERTRAUE
- 22 Fragen an dein Herz, die dein Leben mit Liebe füllen
- Mutterschaft und mentale Gesundheit: Julia Knörnschild über Wochenbettdepressionen, Tagesklinik und ADHS
- Die 6. Staffel Bar-Talk auf frnd.tv: Felix Lobrecht, Düzen Tekkal und BRKN über persönliche Herausforderungen und mentale Gesundheit
- Antisemitismus als Seismograf, um gesellschaftliche Verhältnisse zu begreifen
- Bischof Hermann Glettler (Hg.) hörgott. Gebete in den Klangfarben des Lebens - zum Jahr des Gebets 2024
- Die Juden im Koran. Ein Zerrbild mit fatalen Folgen
- "Erleuchtung kann jeder" von einem der bekanntesten deutschen spirituellen Lehrer
- SARGGESCHICHTEN. Warum selbstbestimmtes Abschiednehmen so wichtig ist
- Kirche am Ende – 16 Anfänge für das Christsein von morgen
- „Entdecke, wer dich stärkt.“: - Diaspora-Sonntag 2023
- AUS ALLER WELT
- Dorfentwicklungsprojekt Jineng auf Lombok: Chancen für Kleinstunternehmer
- Ein sicherer Ort für besondere Kinder
- Neues Video: Hilfe zur Selbsthilfe mit Non-Profit-Mikrokrediten
- Palma Aquarium zieht Bilanz: 2024 war ein Rekordjahr für den Meeresschutz
- Armut bekämpfen durch Hilfe zur Selbsthilfe: Erlebnisse auf den Philippinen
- Schmetterling des Jahres 2025: Die Spanische Flagge
- Neue Videos zeigen emotionale Momente einer inspirierenden Reise
- Zehn Jahre Global Micro Initiative e.V. – Ein Jahrzehnt der Chancen und Veränderungen
- Nusa Penida, Indonesien: Kleinstunternehmer durch Global Micro Initiative e.V. bereit für die Zukunft
- Die Philippinen als kulinarisches Zentrum - Der Inselstaat als Gastgeber des ersten UN Tourism Regional Forums on Gastronomy Tourism
- Global Micro Initiative e.V.: Mit internationalem Kick-off-Event ins Jubiläumsjahr
- Leben auf dem Müllberg in den Philippinen
- Mosel-Apollofalter ist Schmetterling des Jahres 2024
- 9 Jahre Global Micro Initiative e.V.: Veränderung und Hoffnung durch Mikrokredite, Schulungen und individuelle Beratungen
- „Kinder sind empfänglicher für Umweltprobleme“
- Zum Tag der Kinderrechte: Kinder haben ein Recht auf Schutz!
- China to go – Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur – 100 innovative Trends und erhellende Einblicke
- Lomboks versteckte Armut: Global Micro Initiative e.V. schafft Perspektiven
- POLITIK
- Neue Folge „Laut gedacht“: Ricarda Lang über den Umgang mit Kritik und den Mut, bei sich selbst zu bleiben
- Medien zwischen Macht und Ohnmacht. Wie Journalismus Vertrauen zurückgewinnen kann
- Fake News bedrohen die Demokratie – wie die Psychologie den Herausforderungen begegnen kann
- Die Corona-Generation – Wie unsere Kinder um ihre Zukunft gebracht wurden
- Die Kunst des kritischen Denkens und Argumentierens
- Drogenkonsumräume: 52.000 Beratungen und kein Todesfall
- KIT-Experte zu aktuellem Thema: Einfluss von KI auf demokratische Wahlen: „Um Missbrauch zu verhindern, bedarf es technologischer und rechtlicher Maßnahmen sowie Stärkung der KI-Kompetenz“
- Zur Bundestagswahl 2025: NIKOLAUS BLOMEs Debattenbuch »Falsche Wahrheiten«
- Bundestagswahl 2025: Wahlprogramme kürzer als üblich, aber immer noch schwer verständlich
- Rolle rückwärts DDR?
- The Last Beluga Whale - Betrachtungen zu einem Lied - von und mit Gert Holle
- Demokratie-Monitoring: 19 Prozent der Deutschen haben rechtspopulistisches Weltbild
- Machtübernahme
- Gier nach Privilegien - Warum uns die Politik in eine Sackgasse führt
- Europas Außengrenzen: Die Gewalt begrenzen, nicht die Menschlichkeit
- Die Initiative „3. Oktober – Deutschland singt und klingt“ feiert 75 Jahre Grundgesetz
- Wer den Frieden will, muss den Frieden vorbereiten
- Gemeinsam die Welt retten? - Vom Klimaalarm zum Green New Deal
- untertan. Von braven und rebellischen Lemmingen – Analyse unseres Opportunismus
- Vielfältig aktiv bleiben – besonders jetzt! - Wir können etwas gegen den Rechtsrutsch tun
- Die zerrissenen Staaten von Amerika
- Tausend Aufbrüche. DIE DEUTSCHEN UND IHRE DEMOKRATIE SEIT DEN 1980ER-JAHREN
- Wieso tut sich Deutschland so schwer, über Macht zu sprechen? Sophie Pornschlegel über die Zukunft der Demokratie
- JELENA KOSTJUTSCHENKO: Das Land, das ich liebe – Wie es wirklich ist, in Russland zu leben
- Landwirtschaft im Sachunterricht
- Das unvergleichliche Abitur
- Stefan Häselis Kommunikationstipps: Mehr Nähe im Alltag
- Vom FC Barcelona zum FC Balgach
- Wir waren in Norwegen und haben dann….
- Die Macht der 3 Sekunden – richtige Rhythmik hilft beim Verständnis
- Wie aus Tipps Life-Hacks wurden
- Aktion gegen fade E-Mails: Raus mit dem Floskel-Filz!
- „Alt, aber sowas von lebendig» - gesagt wie im 13. Jahrhundert und keiner merkt’s!
- Schön darum-herum-geredet ist auch die Wahrheit vertuscht
- Effektive Kommunikation in herausfordernden Zeiten
- Schreiben lassen heißt auch denken lassen – erkennen Sie die Täterschaft!
- «Ein gutes, neues Jahr» – aber wie lange eigentlich?
- Lampenfieber - oder wenn die Lampe fiebert
- Konkret ist konkreter
- btw…by the way – übrigens, wo wir gerade dabei sind…
- Von Emojis und «ich glaub, du hast mich falsch verstanden»
- Oh ja…die Ferien waren wunderbar!
- Etwas Optimismus in der Sprache kann nie schaden oder besser: es nützt!
- Ein besonderes Geschenk richtig übergeben. So könnte es gelingen.
- Stimme kommt von Stimmung – stimmt!
- Machen Sie doch mal Komplimente, insbesondere da, wo es niemand vermutet!
- «Ich nicht, aber der andere auch.»
- «Ich sag dir’s nur noch einmal!»
- Der (kommunikative) Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler
- WIRTSCHAFT
- Innovation und Transfer in der kommunalen Bildungsarbeit
- „Mit Mut, Herz und Haltung“
- Künstliche Intelligenz im Unternehmen
- Mit Wertschätzung zu mehr Motivation
- GPT statt www: Brauchen wir das Internet noch?
- KI-Wissen für Führungskräfte
- Empathische Führung: Der Life Hack von Lunia Hara in Zeiten von Fachkräftemangel und Quiet Quitting
- "Wer hat recht?"
- Unscripted: Wie Sie aus dem 9-to-5-Gefängnis ausbrechen, Ihr Business aufbauen und endlich frei und selbstbestimmt leben
- Verkaufstricks aus der Welt der Spionage
- Projektmanagement für inoffizielle Projektleiter
- Längst überholte Glaubenssätze überwinden mit „Women at work“ von Silke Rusch
- Welches ist das beste Girokonto?
- Mit Methoden begeistern: Die besten Tools für wirksame Lernmomente in Seminaren, Trainings und Workshops
- Ungeplante Abwesenheiten reduzieren und die Mitarbeitendenmotivation steigern
- Job Crafting - Schritt für Schritt zum Arbeitsalltag, der zu mir passt
- Zukunftstechnologie: Erneuerbare Energien
- Platz schaffen für Neues im Unternehmen: "Exnovation und Innovation"
- Positiv führt! Mit Positive Leadership Teams und Organisationen empowern
- How Big Things Get Done
- Charlie Chaplin – Erfolgsgeheimnisse einer Legende
- Kopföffner für regeneratives Wirtschaften: Re:thinking Sustainability
- Energie am Wendepunkt: Mario Weißensteiner über die Schlüsseltechnologien und Herausforderungen der nächsten Dekade
- Sicherheit für Gründer:innen im ersten Jahr mit: "Der Gründer-Cheatcode"
- Frauen können das Handwerk bunter gestalten – Bauschreinerin Mara Pischl über Frauenpower auf der Baustelle
- Mit 330 PS in ein neues Leben
- Benkos Luftschloss
- China: Schwindende Träume auf der Schnellspur
- Durchbruch
- Mythos Tankstelle. Notizen zu einer Institution in Vergangenheit und Gegenwart
- Wegweiser zu einem zeitgemäßen Entgeltsystem: "Fair Pay"
- Prompting like a Pro. KI im Verkauf erfolgreich einsetzen
- Oma wär ein verdammt guter CEO
- Massiver Fachkräftemangel in den Ingenieur- und Informatikberufen: Jährlicher Wertschöpfungsverlust liegt bei bis zu 13 Milliarden Euro
- KI in der Unternehmenspraxis
- Experte rät Firmen: Fitmachen im Sommerloch
- Mit DesignAgility die Zukunft gestalten
- Die digitale Bevormundung
- BWA: Wirtschaft erwartet „Herbst der Bürokratie“
- Drei Fragen zur Treibhausgasminderungs-Prämie
- Die Europäische Zentralbank: Herrschaft Abseits von Volkssouveränität
- 6 smarte Tipps für einen energieeffizienten Sommer
- Gemeinsam statt einsam: Raus aus der Isolation
- Deutscher Spendenmonitor: Immer mehr Menschen sind zunehmend länger auf Social Media unterwegs
- „Weltall der großen Formen“: Mit Goethe und Feininger durchs Weimarer Land
- KI-Revolution der Arbeitswelt
- Dein Turbo in die neue Medienwelt: 111 Tipps und Tricks für Instagram, Facebook, Twitter, YouTube & Co.
- "Neugierde – der zu wenig beachtete Treiber für Kreativität und Einfallsreichtum"
- Resonanz kraft Persönlichkeit: Wie Sie endlich gehört, gesehen und gelesen werden
- Der Stellar-Approach
- Urlaub und Arbeiten richtig kombinieren mit Hilfe des TaschenGuides "Workation" von Omer Dotou
- 77 magische Bilder, die dich stärker machen: Das inspirierende Motivationsbuch
- Generative Künstliche Intelligenz - ChatGPT und Co für Bildung, Wirtschaft und Gesellschaft
- Science-Publikation: Schluss mit einseitiger industrieller Landwirtschaft
- Gamechanger Künstliche Intelligenz
- Nachhaltigkeit als Schlüssel für erfolgreiche Geschäftsmodelle: „Sustainability als Innovationstreiber“
- Unterschiedliche Generationen setzen beim Spenden je eigene Akzente
- Wenn der Schoko-Osterhase unerschwinglich wird
- Der Gastbeitrag: Kreativwashing
- Digital Report 2024: 23,56 Millionen Deutsche swipen etwa 38 Stunden pro Monat auf TikTok
- Soziale Arbeit für dummies
- Gastbeitrag: Mit Mathematik gegen Angst vorm Scheitern - Dr. Johanna Dahm motiviert Manager mutiger zu handeln
- Gastbeitrag: Psychologische Sicherheit: Unser Einfluss im Alltag
- Gastbeitrag: Mit Dr. Johanna Dahm Zeitenwende trotzen - Weg von 'Vielleicht' - 10 Strategien für die Zeitenwende
- DER GASTBEITRAG: Die Kunst der Verunsicherung – eine unkonventionelle Perspektive
- WISSENSCHAFT
- Agroforst im Weinbau: Bäume stärken Reben – bei gleicher Weinqualität
- Nature-Publikation: Mechanische Spannungen als Treiber der Evolution
- Cell-Publikation: So regulieren Pflanzen ihre Abwehr
- Wiederentdeckte Nutzpflanzen stärken Ernährungssicherheit in Afrika
- Kommunikation über Bläschen: Med Uni Graz erforscht Archaeen-Vesikel und ihre Bedeutung für das Darmmikrobiom
- Verständliche Wissenschaft im Rampenlicht - Klaus Tschira Stiftung zeichnet acht Forschende mit dem KlarText-Preis für Wissenschaftskommunikation 2025 aus
- Internationaler Gold-Standard: AACSB-Siegel für Wirtschafts- & Sozialwissenschaften der Universität Hohenheim
- Dies academicus 2025: Uni Hohenheim zeichnet Engagement & Spitzenleistungen aus
- Brot der Zukunft: So wird Weizenbrot noch nährstoffreicher
- KIT-Expertinnen und -Experten zum Wissenschaftsjahr 2025 – Zukunftsenergie
- Klimaschutz und Darmgesundheit: EU fördert Mikrobiomforschung in Graz
- KI-Studie: Nur jede zweite Quelle stimmt
- Was kann künstliche Intelligenz?
- Exzellenz-Strategie: Uni Hohenheim punktet bei Vergabe von Exzellenz-Clustern
- CHE-Ranking 2025: Nur Best-Noten von Studierenden für Food- und Biotechnologie
- Colloquium Fundamentale: Entwicklungen, Ereignisse und Kontroversen in der Geschichte des KIT
- Vom Reststoff zum Rohstoff: Smarte Tools für eine nachhaltige Bioökonomie
- Wut-Meter: Neue Wut-Skala sagt Konfliktpotentiale am Arbeitsplatz voraus
- Treibhausgasbilanzierung 2023: Klima-Fußabdruck der Universität Hohenheim wird kleiner
- Ökologisch und sozial – aber smart: Wie Tech-Giganten Nachhaltigkeit und KI verbinden
- Agri-PV in Mooren: Solarstrom könnte Wiedervernässung attraktiver machen
- Mehr Transparenz – Kostenfallen abbauen!
- 2. New Food Festival Stuttgart: Wie Innovationen die Lebensmittelbranche revolutionieren
- Exotischer Garten: Bauarbeiten bringen neuen Glanz für grünes Juwel
- Die Energiewende verstehen: Wie Modelle Zukunft formen
- Zecken & FSME: Forschende erwarten 2025 erneut zeckenreiches Jahr
- Darmdetektive im Einsatz: DNA-Spuren entschlüsseln Ernährungsgewohnheiten
- Bundesbericht 2025 zu jungen Wissenschaftler:innen in Deutschland: Daten zu Beschäftigungsbedingungen, Karriere und Qualifizierung
- StudyCheck Award: Studierende küren Uni Hohenheim zur „Top Universität 2025“
- Resonanz schafft Perspektiven: Gelingende Beziehungen für mehr Nachhaltigkeit im Schwarzwald
- Initiative Bioökonomie: Positionspapier fordert Stärkung nachhaltiger Wirtschaft
- Projekt des Monats Januar 2025: Robustes und vielseitiges Getreide in Zeiten des Klimawandels
- European Union Prize for Citizen Science 2025: Einreichungen möglich
- Verhaltenssüchte personzentriert verstehen und behandeln
- Besondere Ehrung: Neues Bakterium trägt Namen der Universität Hohenheim
- Ausschreibung UMSICHT-Wissenschaftspreis 2025 – jetzt bewerben!
- EU-Horizon-Projekt zur Flugtüchtigkeit von Pilot*innen mit Diabetes: Forschung in der hypobaren Kammer
- „Making Medien! Coding Pädagogik?“
- Fakten, Fakes und Volksverdummung: Der Umgang mit Fehl- und Desinformation
- Mehr Nachhaltigkeit in der EU: 5 Jahre European Bioeconomy University
- Hohenheimer Lehrpreis 2024: Universität Hohenheim zeichnet exzellente Lehre aus
- Bessere Bodenqualität im Gartenbau durch Kreislaufwirtschaft
- Charlotte Bruns widmet sich der Stereofotografie
- Naseweis: Die elektronische Nase zur Bestimmung der Frische von Lebensmitteln
- Baum des Jahres 2024: Die Mehlbeere
- Tierisches Teamwork: Bienen, Fledermäuse und Vögel fördern gemeinsam die Macadamia-Produktion
- Mensch schlägt Maschine: Im direkten Wettbewerb unterliegt Kunst aus dem Computer
- Windenergie: Falschinformationen über Windräder sind weit verbreitet
- SCIENCE Publikation: Ameisen betreiben Landwirtschaft – seit 66 Millionen Jahren
- Prof. Dr. Stephan Dabbert verstorben: Uni Hohenheim erschüttert über Tod ihres Rektors
- Neue Impulse für Wissenschaftsdebatten: Ab Oktober startet das renommierte ZAK des KIT als Studium Generale. Forum Wissenschaft und Gesellschaft (FORUM) neu durch
- Weniger Treibhausgase durch Linsen- und Bohnenanbau
- Uni Hohenheim ist „Attraktivster Arbeitgeber Stuttgarts“
- Zwischen öko & konventionell: Erste Versuche mit neuem Anbausystem verlaufen erfolgreich
- „Lebe deinen Traum!“ - Felicitas Mokler macht als Wissenschaftsjournalistin und Buchautorin die Geheimnisse des Universums greifbar
- Wissenschaft selbstgemacht: Uni Hohenheim lädt ein ins Schülerlabor
- Agrarforschung und Food Sciences: Uni Hohenheim bleibt Deutschlands Nr. 1 im NTU-Ranking
- Hybride Welten: Konferenz zur Interaktion zwischen Mensch und Computer
- Künstliche Intelligenz: Relevanz von Digitalkompetenz & kritischem Denken steigt
- Wohlwollende KI: Umweltmotivierte Menschen üben positiven Einfluss auf KI aus
- KI & Ernährung: Chatbots eignen sich nur bedingt für Ernährungsempfehlungen
- Automatische Spracherkennung und -übersetzung: Schnelleres Arbeiten und Lernen
- Wertschätzung: Ein Schlüssel zur Agrarwende
- Universität Hohenheim beruft fair und transparent: DHV bestätigt Gütesiegel für weitere fünf Jahre
- Früher wieder Autofahren nach Anfällen - Studie des Epilepsie-Zentrums Bethel macht Erkrankten Hoffnung
- Stark bleiben in herausfordernden Zeiten - Zuversicht kann man "lernen"
- Multitalent Stadtbaum - Gesunde Bäume für mehr Lebensqualität
- BUCHJOURNAL
- Befreiungsschlag: Hoffnungsschimmer für eine verloren geglaubte Welt
- Art Essentials: Fotografie betrachten
- Die Füße im Sand, die Nase im Wind
- Von Tür zu Tür - Wiener Geschichten
- Die Abgelehnten
- Der alte Mann und das Geschenk des Lebens - von Leene Ehrlich
- Auf gute Nachbarschaft! Warum das Zusammenleben manchmal gar nicht so einfach ist
- Ein berührender Roman mit Sogwirkung: "So nah, so hell"
- Punkt zu Punkt: Deutschlands Schätze entdecken
- „Radikal menschlich”: Alois Prinz beleuchtet Albert Schweitzer zum 150. Geburtstag
- Gute Idee! In sieben Schritten kreativ denken lernen
- Therapie als Weg zum sinnvollen Ganzen
- Der Zauber des Berges
- Über die Herausforderungen unseres Zeitalters
- Sind wir noch zu retten?
- Lasst uns streiten! von Birte Karalus
- Die Unmöglichkeit des Lebens
- Die Katze, die nach Weisheit sucht
- CLARA. Künstlerin, Karrierefrau, Working Mom
- Zwischen Welten und Worten - Transkulturelle Übersetzungsprozesse in der Jesuitenmission des 18. Jahrhunderts bei Florian Paucke
- Fesselnde Erzählungen treffen auf wertvolle Lebensweisheiten
- Leben wie Gandhi
- 1 Jahr und 70 Dates - Eine geschiedene Buchhändlerin wagt den Sprung in den Großstadttrubel Tokios
- Trennungsangst bei Hunden
- Dalai Lama: Von Herz zu Herz - Eine Geschichte von Hoffnung und Liebe zu unserer Erde
- Für eine Kultur des Miteinanders und der Potenzialentfaltung: "Die Metamoderne"
- Alle an Bord?
- Bertha Benz und die Straße der Träume
- Frau Allerhand. Heitere Sprachspielpoesie. 116 Einreimgedichte
- Eine Welt ohne Rassismus
- Huldrychs Ende – Ein satirischer Kriminalroman von Thomas Michael Glaw
- Dein Herz, mein Herz
- Guten Tag, hier spricht Ihre Kapitänin
- Ermutigende Texte über Zuversicht, Nächstenliebe und Kraftquellen - Neues Buch „Entdecke, wer dich stärkt“ erscheint am 13. März
- Und dann kam Lämmchen
- Perfekte Menschen
- Schottische Highlands, Intrigen und Leidenschaft im 15. Jahrhundert: Auftakt der neuen historischen Saga über die MacKay-Schwestern
- Therapeutische Dreiecksbeziehung: Tom Sallers "Ich bin Anna" über das Schicksal der Tochter Sigmund Freuds erscheint am 21. Februar im Kanon Verlag
- KLIMAPOLITIK: DIE OPTIONEN - Von Massenverbrauch und Einzelverzicht
- Franz Kafka und sein Berufsleben: eine völlig neue Sicht auf einen der bekanntesten deutschsprachigen Autoren
- GESCHICHTE
- DIE SPUR DES SILBERS
- Geschichte von Meer und Mensch: Nikolas Jaspert, "Fischer, Perle, Walrosszahn"
- Kreisky, Israel und die Juden
- Die Bundesrepublik. Eine visuelle Geschichte
- »Die Goldene Bulle von 1356« bei wbg Theiss - Spätmittelalterliche Verfassungsgeschichte neu erzählt
- Latein: wie eine Sprache die römische Welt zusammenhielt – neu im Nünnerich-Asmus Verlag
- Die Pionierinnen. Wie Journalistinnen nach 1945 unseren Blick auf die Welt veränderten
- Jüngste Zeiten - Archäologie der Moderne in der Rhein-Ruhr-Region
- Der Stein der Weisen. Geschichte der Alchemie - Studioausstellung 27. September 2023 – 30. Juni 2024
- WOHLBEFINDEN
- Erfüllter leben mit Minimalismus
- Working Woman: Was ich zu Beginn meiner Karriere gerne über das Leben gewusst hätte
- Daniel Haas und Janosch Schobin über Einsamkeit und Beziehungen – Podcast „Kopfsalat“
- Die Top 10 Trends für die Fastenzeit
- Markus Kavka über Thema mentale Gesundheit im FRND-Bar-Talk
- Blasenentzündung vorbeugen
- „Hormongesteuert“: Wechseljahre-Podcast von MDR AKTUELL geht in die 3. Staffel
- Richtig atmen, besser leben
- Darmentzündungen: Intervallfasten könnte bei chronischen Erkrankungen helfen
- Jenseits der Hast: Barrierefreie Auszeiten für Naturgenießer
- Wege aus der Einsamkeit: Strategien für mehr Verbundenheit
- Warum ich keinen Alkohol mehr trinke
- Amanda Armstrong: Heilen mit dem Vagusnerv
- Was uns wirklich nährt
- "Demenz. Nicht Jetzt!" vom Demenzexperten Prof. Dr. med. Klaus Fließbach
- Projekt Lebensverlängerung
- Superkraft Vagusnerv
- Podcast Kopfsalat - Social Media und mentale Gesundheit
- Woche der Seelischen Gesundheit 2024: REDEZEIT FÜR DICH zeigt Unternehmen, wie es geht
- Gürtelrose trifft nicht nur ältere Menschen - Was die Virusinfektion begünstigt und was Betroffene dagegen tun können
- Podcast „Kopfsalat“: Migration und mentale Gesundheit
- Warum ist Schlaf so wichtig für den Körper?
- Pyjama Secrets
- Gesundheitsrisiken für Gamer: Was man tun kann, damit Mausarm & CO nicht zum Game Over werden
- Podcast „Kopfsalat“: Chronische Erkrankung und mentale Gesundheit
- Die 6 Schlüsselfaktoren für Mut, Mindset und Motivation: "Weil Erfolg nicht das ist, was du denkst" von Monika Sattler ist im Juli bei Haufe erschienen
- Viel Lärm um Achtsamkeit
- Sei neugierig!
- GESCHENKIDEEN
- KINDER + JUGEND
- Studie: Zwei Drittel der Eltern wollen beste Freunde ihrer Kinder sein
- Nachts in der Kirche – ein Online-Escape-Spiel für Kinder zwischen 5 und 10 Jahren
- Lehrmittel von fischertechnik begeistern für Technik-Themen: Ganztagsunterricht mit kreativen Konzepten aufwerten
- Conni spielt Fußball!
- Universal Music Family Entertainment / Karussell präsentiert das Conni-Hörspiel „Klar kann Conni das! / Conni lernt teilen, vertrauen und sich vertragen”
- Feinstes Ohrenkino: „LILO & STITCH – DAS ORIGINAL-HÖRSPIEL ZUM DISNEY REAL-KINOFILM“
- „Y-Kollektiv“-Doku vom MDR beleuchtet gefährlichen Messer-Hype unter Jugendlichen
- Mediensucht bei Kindern – zwischen Panikmache und Realität
- Du wusstest doch, dass ich Kinder habe!
- Generation TikTok
- „Mission magisches Tagebuch“: Neue Staffel des Mental-Health-Podcasts
- Anschlag in Mannheim - So helfen Sie jetzt Ihrem Kind
- Die kleine Schnecke Monika Häuschen“ feiert Jubiläum!
- Piraten ahoi: Hier kommt Nina macht Zähneputzen zum Abenteuer im neuen Kindersong
- So schützen Eltern ihre Kinder vor Datenfallen im Netz
- Du bist nicht mehr mein Freund
- Warum sind Quallen durchsichtig?
- Die 5 No-Gos, wenn eine wichtige Prüfung ansteht
- Superkraft Wut - Ratgeber "Damit mein Kind sich besser fühlt"
- Clever mit Comics: WAS IST WAS Wissen – erstmals als Abenteuer-Comic!
- "Die Schule der magischen Tiere": Elisa und ihre Wölfin Silber fahren auf eine Waldfreizeit!
- Universal Music Family Entertainment / Karussell präsentiert: „LUCKY LUKE“ - 3 neue Originalhörspiele zu den gleichnamigen Comics in einer CD-Box!
- Klein, aber oho! Kugelspringer Schwuppdiwupp zu Gast im Garten der kleinen Schnecke Monika Häuschen und ihren Freunden!
- Reisezeit ist Lesezeit: Mit Zeitschriften im Urlaub Langeweile überbrücken und nebenbei Lesefreude wecken
- Gemeinsam gegen soziale Benachteiligung: Fernsehlotterie und Jugendherbergen sorgen mit Ferien-Camps für strahlende Kinderaugen
- Kinder und Jugendliche in Not: Psychosoziale Hilfe per Smartphone
- Sensibilisierung für Zahngesundheit – Reportage aus dem Kindergarten
- Der tapfere Pusti und seine Freunde
- Lernen sichtbar machen. Das Praxisbuch. Erfolgreich unterrichten mit dem Luuise-Verfahren
- Visible Learning 2.0
- Frische Abenteuer für große und kleine Kinder
- „Helle Sterne, dunkle Nacht" von Lisa-Viktoria Niederberger – Wissenswertes über Lichtverschmutzung für Kids ab 5
- Universal Music Family Entertainment / Karussell präsentiert die Hörspielserie: „IDEFIX UND DIE UNBEUGSAMEN“
- Auf der Zielgeraden: DEICHMANN sucht Deutschlands fitteste Grundschule
- Mit minimalem Aufwand zum 1,0-Abitur: „Bestnoten ohne Stress“ von Lara Emily Lekutat hilft Schüler*innen, schulische Ziele effizient zu erreichen
- Legasthenie und Dyskalkulie - Erste Informationen zu Lernstörungen für Kinder und Eltern
- KOCH-Ecke
- Simply Coffee
- Blick in den Vorratsschrank: Diese Lebensmittel halten besonders lange
- Spitzenküche für zu Hause
- Endlich kochen
- Deutsches Superfood - Nährstoffwunder aus der Heimat
- Buchtipp für die magischste Zeit des Jahres: „Das Kochbuch für die Rauhnächte“ von Patrick Rosenthal
- Die größten plant-based Ernährungs-Mythen
- Vegetarische Köstlichkeiten aus dem Airfryer
- Ribera del Duero: Weinbegleitung für das perfekte Sommer-Menü vom Grill
- Heute lieber mal vegan – Sehnsuchtsrezepte für Neugierige
- Das Trendthema Haltbarmachen in seiner ganzen Vielfalt: Grünes Kraut & Rote Beete
- BESINNLICH UND HEITER
- KULTUR
- REGIONAL
- Wir in Oberhessen
- Eiscafé Dolomiti – Genuss im Herzen von Nidda
- European Elvis Festival 2025
- „Goldene Blasen – Wenn der Traum vom Glanz uns die Augen trübt“
- Gerds Musikmagazin - Songs & Talks
- PR-Agentur Himmel & Holle: Design + Sein
- La CAMERATA CHIARA begeistert in der Liebfrauenkirche Schotten
- FORTUNA THEATER - Alena Neubert lebt ihren Traum
- Von der Diakonie-Werkstatt Wetterau zum AKTIV Werk Wetterau
- Naturkostladen Lebenswert e.V. in Nidda
- Willkommen im Café Zeitlos im Herzen von Schotten
- Wir bieten Betreuung daheim an - Diakonie Dienstleistungen Wetterau gGmbH
- Ein Song für Dich
- KinoTraumstern und kuenstLich e.V.
- Ki-Fu® Training – von und mit Joel S. Wright
- Der Bunte Acker in Wallernhausen, eine solidarische Landwirtschaft
- Rotary Club Nidda - Gib der Welt Hoffnung
- Yoga Nidda
- Salzbach - Die Location mit dem besonderen Charme
- Textildruck-Heilmann
- Wir in Oberhessen
- DER DENKANSTOSS
- Mit dem Herzen beten - Gedanken zum Sonntag Rogate - von und mit Gert Holle
- Ein ganz normaler Tag - oder doch nicht?
- Europa bauen
- Prellböcke im Leben - 27.01.2025
- Stand up!
- Zeit ist ein Geschenk Gottes
- Es ist wunderbar - eine Weihnachtsgeschichte von und mit Gert Holle
- Ein Stück Himmel auf Erden
- Einen besseren Lebensweg suchen - Gedanken zum Buß- und Bettag von und mit Gert Holle
- Warten auf Grün
- Wenn es ernst wird ...
- Eine bessere Wahl
- Sensibel, offen, sorgfältig
- Seid mutig, wagt etwas!
- ... dann fällt Dein Blick auf Gott
- Lebensfreude schenken
- Loslassen, Mut aufbringen, vertrauen
- Wie Fische im Wasser
- Labyrinthisch eben
- Wo du durchatmen kannst ...
- Liebe, Glück und Zuversicht
- Sahne oder geschäumte Milch
- Wo sich Himmel und Erde begegnen
- Wenn der Boden ins Wanken gerät ....
- Dann blüht uns allen wieder Gutes
- Menschen mit leichtem Gepäck
- Auf den Punkt gebracht
- Springen, klatschen, singen
- Von Gott, für uns
- Die Kunst der kleinen Schritte
- Schluss mit Routine
- Wie eine herzliche Umarmung Gottes
- Das Leben ist eine Rose
- Immer mehr haben wollen
- Liebe, Glück und Zuversicht
- Die Erde ist voll der Güte des Herrn
- Gut Ding will Weile haben
- Komm, sag es allen weiter!
- Der Weg der Befreiung und Erlösung
- Werden wir bei ihm bleiben?
- Mehr als eine Tischgemeinschaft
- Hängematte
- PREDIGT
- Besinnung: Was heißt Leben?
- Hörpredigt September 2025 – Sorgt euch nicht!
- Carry On – Wenn das Leben schwer wird - eine Besinnung von und mit Gert Holle
- The House at the End of the Street - eine Besinnung von und mit Gert Holle
- Wo warst Du? - Eine Besinnung über Mitverantwortung, Erinnerung und Hoffnung
- Hörpredigt August 2025 – Wie ist Gott?
- „It’s My Song“ – Eine Sommerbesinnung zwischen Himmel und Melodie
- Süßes Leben – trotz allem - Eine Besinnung für Menschen mit Diabetes von und mit Gert Holle
- Hörpredigt Juli 2025 – Reisebegegnungen
- Was bleibt? - Eine Besinnung von und mit Gert Holle
- Vertrauen im Fluss des Lebens – eine Besinnung zu dem Song „Lass es fließen“ – von und mit Gert Holle
- Hörpredigt Juni 2025 – Zäune überwinden
- Die Liebe Gottes weitergeben - Gedanken zu Christi Himmelfahrt - von und mit Gert Holle
- Ein Herz. Ein Licht. - Eine Besinnung für junge Leute - von und mit Gert Holle
- Gott hört dich. Auch im Flüstern - Besinnung von und mit Gert Holle
- Worte, die tragen - Worte, die Treffen - eine Besinnung von und mit Gert Holle
- Hörpredigt Mai 2025 – Außen und innen
- „Porcelain People“ – Wenn Sanftheit auf Härte trifft
- Manchmal und immer wieder - eine Besinnung über das Schwanken, das Suchen und das Getragen-Sein
- Hörpredigt zu Ostern 2025 – Interview mit Maria
- Hörpredigt April 2025 – Eine andere Sicherheit
- Die Zeit in Gottes Händen - Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft im Licht des Glaubens
- Gesicht zeigen – Eine christliche Besinnung von und mit Gert Holle
- Sehnsucht nach echter Freundschaft - eine Besinnung von und mit Gert Holle
- Hörpredigt März 2025 – Mir passiert das nicht
- Die Freude der Musik - eine Besinnung von und mit Gert Holle
- Erinnerungen, die uns tragen - eine Besinnung von und mit Gert Holle
- Wandel beginnt mit Umkehr - eine Besinnung von und mit Gert Holle
- LIFE - Leben in Fülle - eine Besinnung von und mit Gert Holle
- Hörpredigt Februar 2025 – Hier ist alles gratis
- FIGHT - eine Besinnung zu dem gleichnamigen Lied von Gert Holle
- 64 Squares - eine Besinnung zu dem gleichnamigen Song - von und mit Gert Holle
- "Türen öffnen – Wege ins Leben" – eine Besinnung zu dem Song OPEN THE DOOR – von und mit Gert Holle
- Besinnung zum Lied SPRECHEN ODER SCHWEIGEN - von und mit Gert Holle
- Besinnung zum Lied WE CAN LEAN ON ONE ANOTHER - von und mit Gert Holle
- Hörpredigt Januar 2025 – Bei uns alle Tage
- Ein Ort, den wir Zuhause nennen können
- Prüft alles, behaltet das Gute - eine Besinnung zu BEHIND THE CURTAIN - von und mit Gert Holle
- Hörpredigt zum Jahreswechsel 2024/25 – Jedem Anfang wohnt das Ganze inne
- Hörpredigt für Weihnachten 2024 – Vom Geheimnis Weihnachten
- „Licht in uns“ - eine Besinnung für junge Leute zu dem gleichnamigen Lied von und mit Gert Holle
- Adventliche Besinnung: TO MARS - von und mit Gert Holle
- Besinnung: In der Kälte der Nacht - von und mit Gert Holle
- Besinnung: In the Stillness of Christmas - von umd mit Gert Holle
- Hörpredigt Dezember / Advent 2024 - Freut euch!
- Besinnung für junge Leute zu dem Lied "HAVEN" - von und mit Gert Holle
- Hörpredigt Buß- und Bettag 2024 – Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe
- Besinnung für junge Leute zu "FIND MY PEACE" - von und mit Gert Holle
- Verantwortung, Freiheit und die Suche nach dem Licht
- Hörpredigt November 2024 - Alles wird gut
- Andacht zum Lied "I feel the Blues" von und mit Gert Holle
- Andacht zum Wochenspruch - 27. Oktober - 3. November 2024
- Andacht zum Wochenspruch - 20. - 26.10.2024
- Break the Chaines – eine Besinnung zum Welttag zur Beseitigung der Armut
- Besinnung zu dem Lied "DIFFERENT EYES" - von und mit Gert Holle
- Andacht zum Wochenspruch - 13. - 19.10.2024
- Hörpredigt Oktober 2024 – Grenzen überwinden
- Andacht zum Wochenspruch - 6. - 12. Oktober 2024
- Besinnung für junge Leute zu dem Lied "A VERY GOOD TIME" von und mit Gert Holle
- Hörpredigt zu Erntedank 2024 - Jesus wirft Seed-Balls
- Andacht zum Wochenspruch - 29.9. - 5.10.2024
- Besinnung für junge Leute zu dem Lied "LASS ES RAUS" - von und mit Gert Holle
- Besinnung für junge Leute zu dem Lied "Autumnbreath" von und mit Gert Holle
- Andacht zum Wochenspruch - 22. - 28. September 2024
- Besinnung für junge Leute zu "COURAGE FOR PEACE" von und mit Gert Holle
- Besinnung für junge Leute zu "BREAK THE SILENCE" - von und mit Gert Holle
- Andacht zum Wochenspruch - 15. - 21. September 2024
- Besinnung für junge Leute zu "YOU ARE HIS ANGEL" - von und mit Gert Holle
- Besinnung für junge Leute zu dem Lied "WORDS" - von und mit Gert Holle
- Besinnung für junge Leute zu dem Lied "Behind Excuses" - von und mit Gert Holle
- Andacht zum Wochenspruch - 8. - 14. September 2024
- Besinnung für junge Leute zu dem Lied "Cappuccino with Cream or Foam" von und mit Gert Holle
- Besinnung für junge Leute zu dem Lied "Two Hours" von und mit Gert Holle
- Besinnung für junge Leute zu IN DIESER ZEIT - von und mit Gert Holle
- Besinnung für junge Leute zu dem Lied "Life wants you" - von und mit Gert Holle
- Besinnung für junge Leute zu "I'm flying to the stars tonight" - von und mit Gert Holle
- Besinnung für junge Leute zu dem Lied HAND IM HAND THROUGH EVERY TIME - von und mit Gert Holle
- Besinnung für junge Leute zu dem Lied "Who could ever forget?" von und mit Gert Holle
- Andacht zum Wochenspruch - 1. - 7. September 2024
- Besinnung für junge Leute zu dem Lied "SUMMERTIME" von und mit Gert Holle
- Hörpredigt September 2024 – Das Ding mit der Liebe
- Besinnung zum Lied "RIDDLE OF LIFE" von und mit Gert Holle
- IM GESPRÄCH
- DEMENZ. NICHT JETZT! - Ein Gespräch mit Prof. Dr. Klaus Fließbach
- Interview des Monats September 2025 - Gerd Schwalm spricht mit der IBO KNÖPP BAND
- Interview des Monats August 2025 - Gerd Schwalm spricht mit Stefan Zauner (ex Münchener Freiheit)
- Interview des Monats Juli 2025 - Gerd Schwalm spricht mit Peter Reber
- Weitere Interviews im Archiv
- Interview des Monats Juni 2025 - Gerd Schwalm spricht mit Martin M. Jones
- Interview des Monats Mai 2025 - Gerd Schwalm spricht mit "SINPLUS"
- Interview des Monats April 2025 - Gerd Schwalm spricht mit Detleff Jones
- Interview des Monats März 2025 - Gerd Schwalm spricht mit DR. DAYDOWN
- Interview des Monats Februar 2025 - Gerd Schwalm spricht mit Yogi von KALLES KAVIAR
- Interview des Monats Januar 2025 - Gerd Schwalm spricht mit Rainer Thielmann
- Interview des Monats Dezember 2024 - Gerd Schwalm spricht mit Cora von "Spielhagen"
- Interview des Monats November 2024 - Gerd Schwalm spricht mit Simon Taglauer
- Interview des Monats Oktober: Gerd Schwalm spricht mit "Two Passengers"
- Gerd Schwalm spricht mit Frieder Gutscher
- Gerd Schwalm spricht mit Markus von „Die Hammers“
- Gerd Schwalm spricht mit Andreas Hausammann
- Gerd Schwalm spricht mit Jelena Herder
- Gerd Schwalm spricht mit Werner Hucks
- Gerd Schwalm spricht mit Jonnes
- Gerd Schwalm spricht mit Daniel Kallauch
- Gerd Schwalm spricht mit Dania König
- Gerd Schwalm spricht mit Markus Kohl
- Gerd Schwalm spricht mit Chris Lass
- Gerd Schwalm spricht mit Anja Lehmann
- Gerd Schwalm spricht mit Beate Ling
- Gerd Schwalm spricht mit Christian Löer
- Gerd Schwalm spricht mit Mateo von der Band "Lux Kollektiv"
- Gerd Schwalm spricht mit Sarah Kaiser
- Gerd Schwalm spricht mit Kris Madarász
- Gerd Schwalm spricht mit Peter und Deborah Menger
- Gerd Schwalm spricht mit Addi M.
- Gerd Schwalm spricht mit Birgit Meyer
- Gerd Schwalm spricht mit Toby Meyer
- Gerd Schwalm spricht mit Adina Mitchell
- Gerd Schwalm spricht mit Chris von der Band NORMAL IST ANDERS
- Gerd Schwalm spricht mit Daniel D. Nowak
- Gerd Schwalm spricht mit Alex von den O'Bros.
- Gerd Schwalm spricht mit Mike Müllerbauer
- Gerd Schwalm spricht mit Matthias Menzel
- Gerd Schwalm spricht mit Naemi
- Gerd Schwalm sprich mit Alena Neubert
- Gerd Schwalm spricht mit Katharina Neudeck
- Gerd Schwalm spricht mit Steffi Neumann
- Gerd Schwalm spricht mit Jennifer Pepper
- Gerd Schwalm spricht mit Lars Peter
- Gerd Schwalm spricht mit David Plüss
- Gerd Schwalm spricht mit Jan Primke
- Gerd Schwalm spricht mit Simone und Gino Riccitelli
- Neue Seite
- Gerd Schwalm spricht mit Norbert Rier von den Kastelruther Spatzen
- Gerd Schwalm spricht mit Peter Reimer
- Gerd Schwalm spricht mit Eberhard Rink
- Gerd Schwalm spricht mit Ute und Friedemann Rink
- Gerd Schwalm spricht mit Sebastian Rochlitzer
- Gerd Schwalm spricht mit Sam Samba
- Gerd Schwalm spricht mit Christian Schnarr
- Gerd Schwalm spricht mit Oswald Sattler
- Gerd Schwalm spricht mit Johannes Schmidt
- Gerd Schwalm spricht mit Michael Schlierf
- Gerd Schwalm spricht mit Gerhard Schnitter
- Gerd Schwalm spricht mit Stefanie Schwab
- Gerd Schwalm spricht mit Markus Schöllhorn
- Gerd Schwalm spricht mit Anna Marie Stein
- Gerd Schwalm spricht mit Thomas Steinlein
- Gerd Schwalm spricht mit der Band "Sternallee"
- Gerd Schwalm spricht mit Christoph Siemons ("SINFOGLESIA")
- Gerd Schwalm spricht mit Linda McSweeny
- Gerd Schwalm spricht mit Fabian Vogt
- Gerd Schwalm spricht mit „Peter Pan“ von „W4C“
- Gerd Schwalm spricht mit Tanja Urben
- Gerd Schwalm spricht mit Kathrin D. Weber
- Gerd Schwalm spricht mit Jürgen Werth
- Gerd Schwalm spricht mit Siegi Wilke
- Gerd Schwalm spricht mit Julie von der Band YADA Worship
- Trauer im Unternehmen - Das Schwere LEICHT gesagt
- Forum
- Service
- Gert Holle - Herausgeber und leitender Redakteur von WIR IM NETZ
- TOP 5 Zahnmythen: Fakten zur Mundhygiene
- Fahrgastrechte im Zugverkehr
- Regelmäßige Vorsorge kann Leben retten: Mythen und Fakten zur Darmkrebsvorsorge im Überblick
- Gefahr im Grünen: Zecken, FSME und Borreliose im Überblick
- Fünf Tipps zur Vorbeugung von Arthrose
- Betreutes Wohnen und Pflege-WGs: Selbstbestimmtes Leben im Alter
- Kopfschmerzen entlarvt: Fünf Mythen im Faktencheck
- Mit weniger Stress durch den Tag: Gezielte Auszeiten und klare Abläufe für neue Kraft
- Zukunft zum Nachrüsten: Wie funktioniert das Smart Home?
- Was bei der Jobsuche wirklich zählt und worauf Talente Wert legen - Fünf Mythen rund um attraktive Arbeitgeber
- Sitzzeiten in Deutschland auf Rekordniveau: Strategien gegen Bewegungsmangel im Alltag
- Die fünf wichtigsten Tipps für eine Wanderreise
- Die häufigsten Brandgefahren: Sicherheits-Tipps für zu Hause
- Fünf Tipps für einen Sommer ohne Wespenstiche: Dos und Don’ts, wenn Wespen den Grillabend stören
- Wie man sich vor Phishing schützt - Fünf Tipps gegen den virtuellen Datendiebstahl
- Beckenboden „underrated“ - Der Underdog unter den Muskelgruppen
- Schwimmen ohne Risiko: Wie Badende Unfälle am und im Wasser vermeiden
- Upcycling: Fünf Ideen für Haus und Garten
- Mückenstiche verhindern - Tipps im Umgang mit Stechattacken
- Fünf Fakten zum Fahrrad
- Fünf Tipps gegen Einsamkeit
- Camping: Freiheit auf Rädern? - Rechtliche Regelungen und Tipps zum Versicherungsschutz
- Neue TOP 5 Sonnenmythen: Die Wahrheit hinter den häufigsten Irrtümern über Sonne und SonnenschutzSeite
- TOP 5 Mythen zu Zecken
- Fünf Dinge, die beim Putzen gerne vergessen werden
- Was tun, wenn das Konto teurer wird?
- Waldbrandgefahr im Frühjahr
- Gesund gärtnern
- Parkinson: Früherkennung und Diagnose
- Sicher auf dem Lastenrad unterwegs
- Was ändert sich mit der Heirat?
- Fahrpraxis auffrischen: Tipps für Zweiradfahrer
- Reifen richtig einlagern - Worauf Autofahrer bei Lagerung und Versicherungsschutz achten sollten
- TOP 5 Mythen zu Vitaminen
- Große Freiheit im kleinen Garten? -/ Welche Vorgaben Schrebergärtner kennen sollten
- Fünf Tipps für nachhaltiges Reisen
- Trugschlüsse im Arbeitsrecht: Was wirklich bei Kündigung, Abfindung und Urlaubsanspruch gilt
- Schutz vor Fahrraddiebstahl
- Fünf Mythen zu Antibiotika
- Fünf Mythen zum Zähneknirschen
- Täuschend echte Fälschungen - So erkennen Internetuser Deepfakes
- Wenn ein Zahn abbricht - Schnelle Hilfe für Kinder
- Fünf Mythen zum Muskelaufbau
- Der Weg zu einer erholsamen Nachtruhe
- Die fünf häufigsten Pläne für den Ruhestand
- Von der Tanne zum Trendsetter: So lebt der Weihnachtsbaum nachhaltig weiter
- Sechs Gründe für alkoholfreien Januar
- TOP 3 häufigsten Schäden am Haus im Winter
- Was bedeuten eigentlich die Zahlen auf dem Thermostat?
- 10 Top-Tipps: Gesund durch die dunkle Jahreszeit
- Frostschäden im Winter vermeiden - Wie Haus und Garten die Kälte gut überstehen
- Neuer Schutz für Neugeborene und Babys vor schwerer Atemwegserkrankung
- Sturmschäden am Auto: Wer haftet, welche Versicherung zahlt und wie sich Kfz-Besitzer vor Sturmfolgen schützen
- Unfallrisiko im Straßenverkehr: Wie Fußgänger, Rad- und E-Scooter-Fahrer sicher unterwegs sind
- Die fünf häufigsten Fragen zum Thema Kinderwunsch
- So schützt man sich bei Hitze
- App der TelefonSeelsorge als Hilfe zur Selbsthilfe bei Krisen aller Art
- Online-Bistumsatlas zeigt Orte und Aktivitäten der katholischen Kirche in Deutschland
- ADAC Notfallpass erleichtert die Rettung - Im Ernstfall können wichtige Notfalldaten über das Smartphone ausgelesen werden
- Evangelisches Onlineportal wächst weiter - Regionalzentrum kirchlicher Dienste Greifswald mit neu gestaltetem Internetauftritt auf www.kirche-mv.de
- Wie verhalte ich mich im Naturschutzgebiet?
- Pinnwand
- Schaufenster
- Blockflöte lernen mit Peter Chorkov – per Skype oder daheim in Wien!
- PR-Agentur Himmel & Holle
- LUCE in Sanità – Wenn Licht aus der Tiefe kommt
- Sina Anastasia: Musik die Herz und Glauben berührt
- Ein Ort der Inspiration und Erholung – Das Stolle-Haus in Grimma
- Katholisches Filmwerk
- La CAMERATA CHIARA
- Ein ganz persönlicher Song für Dich
- Salzbach - Die Location mit dem besonderen Charme
- Textildruck-Heilmann
- Yoga Nidda
- Angerer d. Ältere
- SITEMAP AKTUELL
- SCHAUFENSTER
Kinderrechte ins Grundgesetz – psychologische Forschung untermauert Notwendigkeit zur Umsetzung der ratifizierten UN-Kinderrechtskonvention
BDP veröffentlicht Positionspapier zum Weltkindertag 2025

18.09.2025
(Berlin/bdp) - Die Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz ist überfällig und die psychologische Forschung zeigt eindeutig: Kinder profitieren in ihrer psychischen, sozialen und kognitiven Entwicklung, wenn ihre Rechte systematisch anerkannt und strukturell gesichert sind. Zum Weltkindertag 2025 unter dem Motto „Kinderrechte – Bausteine für die Demokratie!“ veröffentlicht der Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen (BDP) ein Positionspapier und fordert „Kinderrechte ins Grundgesetz“, denn es braucht einen klaren verfassungsrechtlichen Rahmen, um die Rechte von Kindern auf Schutz, Förderung und Beteiligung nach Artikel 3 der UN-Kinderrechtskonvention nachhaltig zu stärken, die seit 1992 auch in Deutschland gelten.
Danach hat jedes Kind das Recht auf Freiheit, Gleichheit, Bildung, Gesundheit und Fürsorge und der BDP stellt in diesem Zusammenhang folgende Forderungen an die Bundespolitik:

AKTUELL BEI WIR IM NETZ - POLITIK - 18.09.2025
Bundesbeauftragte gegen sexuellen Missbrauch fordert verpflichtende Schutzkonzepte für Jugendreisen

10.09.2025
Kerstin Claus: Schulungen von Teamerinnen und Teamern zum Schutz Jugendlicher vor sexualisierter Gewalt nötig / Neue „Vollbild“-Recherche „Partyurlaub außer Kontrolle – wie sicher sind Jugendreisen?“ ab Dienstag, 9. September 2025 in der ARD Mediathek
(Mainz/Berlin/swr) - Die unabhängige Bundesbeauftragte gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen, Kerstin Claus, fordert im Interview mit dem SWR-Investigativformat „Vollbild“, dass Veranstalter von Kinder- und Jugendreisen in Zukunft Schutzkonzepte vorlegen müssen. Exklusive Recherchen von „Vollbild“ zeigen, dass es bei kommerziellen Party-Jugendreisen zu Übergriffen, Alkoholexzessen und sexualisierter Gewalt kommt. Die „Vollbild“-Doku „Partyurlaub außer Kontrolle – wie sicher sind Jugendreisen?“ ist ab Dienstag, 9. September 2025, 5 Uhr in der ARD Mediathek abrufbar.
"Demokratie braucht Mut!"
18.09.2025
(Berlin/Frankfurt am Main/ib) "Demokratie braucht Mut!" - diese Botschaft ging vom 3. IB-Kongress mit dem Titel "Zusammen! Für Vielfalt, Teilhabe und Demokratie" aus. Am vergangenen Wochenende versammelte die hybride Veranstaltung des freien Trägers der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit Fachleute aus Praxis, Wissenschaft, Politik, Medien und Verwaltung in Berlin. Zudem zog sie rund 300 Teilnehmende an.
Besonders wichtig war dem Organisationsteam, dass Kinder und Jugendliche vor Ort ihre Interessen vertreten und ihre Positionen gleichwertig einbringen konnten. IB-Präsidentin Petra Merkel eröffnete den Kongress und betonte die Bedeutung gesellschaftlichen Zusammenhalts. Er müsse vor allem aktiv gestaltet werden. Demokratie lebe nicht vom Zuschauen, sondern vom Mitmachen. Sie zitierte den ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff: "Demokratische Vielfalt mag manchmal anstrengend sein, aber ihr Gegenteil ist Einfalt."
In seiner Keynote kritisierte Journalist und Autor Dr. Ronen Steinke den Mythos, Institutionen wie der IB dürften keine politischen Positionen einnehmen, weil sie Steuergeld erhalten: "Für das Grundgesetz darf man auf jeden Fall eintreten. Ich erwarte das geradezu von Ihnen", betonte er.
Hugo, sechs Jahre alt, gründete die "Eiscreme-Partei" und gewann mit ihr die Wahl in seiner Kita
Der IB stellte einige seiner vielen Praxis-Projekte für Demokratie
vor: Der sechsjährige Hugo aus Jena berichtete, wie er mit seiner selbstgegründeten "Eiscreme-Partei" die Wahl zum Parlament seiner Kita gewann. Er erklärte, wie wichtig gemeinsame Ziele in der Politik sind - in Hugos Fall das gemeinsame Eisessen. Der neunjährige Elijah gab Einblick in seinen Alltag im IB-Kinderhaus "Tim Täumel" bei Leipzig. Schüler*innen des bunta Bildungszentrums für Gesundheit und Soziales beim IB in Rostock berichteten von ihrer Teilnahme an der Aktion "Schule ohne Rassismus". Die anwesenden Sprecher*innen der IB-Freiwilligendienste wiesen darauf hin, dass ein Freiwilliges Soziales Jahr kein Privileg sein darf, das Kindern wohlhabender Familien vorbehalten ist.
Weitere Themen des IB-Kongress waren unter anderem die Rahmenbedingungen für ausländische Fachkräfte in Deutschland, die bedarfsgerechte Umsetzung von Inklusion in den Erziehungshilfen, digitale Bildung sowie Geschlechtergerechtigkeit.
Prof. Karim Fereidooni von der Ruhr-Universität Bochum erklärte in seinem Beitrag zum Demokratieverständnis junger Menschen mit und ohne
Migrationsgeschichte: "Rassismus ist kein Kampf zwischen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund, sondern eine Kulturfrage." Viele Mitschnitte und Präsentationen werden in Kürze unter www.kongress.ib.de für alle Interessierten veröffentlicht.
Mitgliederversammlung stimmt für Stärkung der Jugendbeteiligung im IB und für eine Satzungsänderung zu Demokratiefeindlichkeit
IB-Präsidentin Petra Merkel bilanzierte im Schlusswort: "Demokratie ist nicht die Herrschaft der Mehrheit, sondern der Schutz der Minderheit. Demokratie braucht deshalb immer auch Mut. Besonders berührt hat mich bei diesem Kongress, zu sehen, wie wichtig es ist, junge Menschen einfach eigene demokratische Schritte gehen zu lassen.
Der IB tut hier schon viel, aber wir wollen mehr!"
Am Tag nach dem IB-Kongress trafen sich die Mitglieder des IB e.V. an selber Stelle. Passend zu den Ergebnissen des Kongresses stimmten sie zwei Anträgen zu: für eine stärkere Beteiligung junger Menschen in den Angeboten und Einrichtungen des IB sowie für eine Satzungsänderung zum Umgang mit IB-Mitgliedern, die offen demokratiefeindliche Parteien unterstützen.
WTO-Fischereiabkommen: Fehlende Fairness für Kleinfischerei
15.09.2025
(Berlin/bfw) - Am heutigen Montag tritt das WTO-Fischereiabkommen in Kraft. Insgesamt gilt das Abkommen als wichtiger Meilenstein. Doch zentrale Probleme bleiben ungelöst – vor allem zulasten der Menschen und Küstengemeinschaften im Globalen Süden. Dazu sagt Francisco Mari, Experte für Meerespolitik und Welternährung bei Brot für die Welt:
„Wir begrüßen, dass die WTO erstmals Umwelt- und Ernährungsfragen im Handelsrecht aufgreift. Doch das Abkommen ist voller Schlupflöcher. Besonders problematisch: Die größten Fangnationen profitieren weiterhin von nicht erfassten Treibstoffsubventionen. Gleichzeitig werden Länder des Globalen Südens durch strenge Berichtspflichten belastet – selbst für Treibstoffhilfen, obwohl ihre handwerkliche Fischerei kaum zur Überfischung beiträgt.
Brot für die Welt fordert daher, dass sämtliche Subventionen vollständig erfasst und offengelegt werden, einschließlich der Namen der begünstigten Fangboote. Vom künftigen WTO-Fischereiausschuss erwarten wir, dass er die Rechte der Fischereigemeinschaften im Globalen Süden stärkt und bestehende Ungleichheiten im Abkommen korrigiert. Illegal fischende Fangflotten müssen gestoppt, die handwerkliche Fischerei gestärkt und die Fischgründe vor den Küsten wirksam vor Plünderung geschützt werden.“
Zum Tag der Wohnungslosen am 11. September
Medizinische Versorgung für wohnungslose Menschen erschwert
Öffentliches Gesundheitssystem ist unmenschlich
10.09.2025
(Frankfurt/dh) - Wer auf der Straße lebt, hat nicht nur seine Wohnung verloren, sondern auch den Anschluss an eine grundlegende Gesundheitsversorgung. Rund 4.000 Menschen leben in Hessen ohne festen Wohnsitz – viele von ihnen sind chronisch krank, psychisch belastet und medizinisch unterversorgt. „Mittlerweile bieten wir in fast allen unseren diakonischen Wohnungsnotfall-Einrichtungen auch regelmäßig medizinische Sprechstunden an“, sagt Carsten Tag, Vorstandsvorsitzender der Diakonie Hessen zum Tag der Wohnungslosen am 11. September. „Doch unser medizinisches Angebot ist nur eine Notfallversorgung“, betont Carsten Tag. „Es ist keine Parallelstruktur zum öffentlichen Gesundheitssystem. Die Leistungen, die wohnungslose Menschen in unseren diakonischen Einrichtungen bekommen, können eine regelhafte Gesundheitsversorgung nicht ersetzen.“ Seit fast 30 Jahren gibt es schon das Projekt „Krank auf der Straße“ der Diakonie Hessen, aus dessen Spendeneinnahmen unter anderem die medizinischen Sprechstunden in den Einrichtungen finanziert werden. Und der Bedarf an der Notfallversorgung wächst.
„Wer jeden Tag sein Überleben sichern muss, obendrein suchtkrank und auch häufig psychisch krank ist, keinen gesicherten Zugang zu Wasser, Toiletten, Nahrung, Kalender hat, der greift nicht zum Hörer, telefoniert die Arztpraxen durch und macht einen Termin aus“, erzählt Katharina Alborea, Referentin für Wohnungsnotfallhilfe der Diakonie Hessen. Eine akute Erkrankung wird dann oft verdrängt. Viele wissen nicht einmal, ob sie eine Krankenversicherung haben und welche Leistungen ihnen eigentlich zustehen. Auch haben die meisten Angst in einer regulären Arztpraxis oder Notaufnahme wegen ihres Erscheinungsbilds stigmatisiert zu werden. Alborea: „Viele wohnungslose Menschen haben schlechte Erfahrungen gemacht und gehen erst dann zum Arzt, wenn die Krankheit schon fortgeschritten ist. Für manche ist das zu spät.“ Katharina Alborea erzählt aus Erfahrung. Sie war selbst jahrelang Sozialarbeiterin in einer Einrichtung und hat wohnungslose Menschen zum Arzt begleitet. „Unsere Angebote sind meist die einzige Möglichkeit, wohnungslose Menschen in besonderen Notlagen medizinisch zu versorgen und sie wieder an das Hilfesystem der Gesundheitsfürsorge heranzuführen.“
Gesundheitssystem überlastet
„Auch wenn die Kommunen gesetzlich verpflichtet sind, für die gesundheitliche Versorgung aller Bürgerinnen und Bürger aufzukommen, ist das System so überlastet, dass es noch nicht einmal für die Menschen ausreicht, die einen Wohnsitz haben“, sagt Carsten Tag. Mit den Einnahmen aus dem Spendenprojekt „Krank auf der Straße“ werden etwa die Materialien für die medizinische Versorgung der wohnungslosen Menschen bezahlt. Allein die Kosten für Sehhilfen für Menschen mit stark beeinträchtigter Sehkraft übersteigen meist die Möglichkeiten von Wohnungslosen. Carsten Tag: „Brillen sind ein wesentlicher Beitrag für eine bessere Teilhabe. Früher gab es noch sogenannte kostenlose „Kassengestelle“. Wie soll jemand die Kosten für eine Brille bezahlen, dem es am Nötigsten zum Leben fehlt? Unserem öffentlichen Gesundheitssystem mangelt es an Menschlichkeit. Wir brauchen einen Fonds für medizinische Behandlungen, der die Kostenübernahme garantiert, und Arztpraxen, die wohnungslose Menschen vorbehaltlos behandeln.“
Gesundheitssystem ohne Barrieren und Diskriminierung nötig
„Wohnungslose Menschen werden in der aktuellen Gesundheitsstruktur nicht barriere- und diskriminierungsfrei versorgt“, sagt Carsten Tag weiter. „Wir erleben es immer wieder, dass Menschen nach medizinischen Eingriffen ohne Anschlussversorgung einfach vor unseren Einrichtungen abgesetzt werden. Das reguläre Entlassungsmanagement greift bei wohnungslosen Menschen nicht, doch unsere Einrichtungen sind nicht auf pflegebedürftige Menschen eingestellt. Unsere Sozialarbeiter*innen sind kein Pflegepersonal! Für die Menschen, die auf der Straße leben, müssen medizinische Leistungen diskriminierungs- und barrierefrei zugänglich sein. Wir haben in einem Positionspapier gezeigt, wie eine Versorgung mit Würde funktionieren kann. Lassen Sie uns nun endlich ein Gesundheitssystem schaffen, das für alle Menschen da ist!“
Die Diakonie Hessen hat zusammen mit den anderen großen Wohlfahrtsverbänden der Liga Hessen ein Positionspapier zur Gesundheitsversorgung wohnungsloser Menschen verfasst. Zum ausführlichen Positionspapier der Liga Hessen
Fachtag „Unsichtbare Patient*innen?“ am 18. September in Frankfurt am Main
Der Fachtag „Unsichtbare Patient*innen? Herausforderungen und Chancen in der Gesundheitsversorgung wohnungsloser Menschen“ der Hessischen Fachkonferenz Wohnungslosenhilfe diskutiert am 18. September in Frankfurt, wie die Gesundheitsversorgung wohnungsloser Menschen gestaltet werden kann. Der Fachtag findet von 10 bis 16:30 Uhr in der Evangelischen Akademie Frankfurt statt und wird von Staatsministerin Heike Hofmann eröffnet. Es sollen gemeinsam Perspektiven entwickelt und auf Grundlage bewährter Praxisbeispiele konkrete Handlungsempfehlungen erarbeitet werden. Das Hessische Ministerium für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales begleitet den Fachtag als wichtiger Partner und fördert den Dialog zwischen Fachkräften, Sozialverbänden und öffentlichen Institutionen. Mehr Infos zur Veranstaltung
Über das Spendenprojekt „Krank auf der Straße“ der Diakonie Hessen
Seit 1996 wird über das Gesundheitsprojekt „Krank auf der Straße“ die medizinische Versorgung von wohnungslosen Menschen finanziert. In vielen Einrichtungen der Diakonie Hessen – etwa in den diakonischen Tagesaufenthaltsstätten (TAS) Marburg, Wiesbaden und Gießen – finden regelmäßig medizinische Sprechstunden statt, oft in Kooperation mit Zahnarztpraxen und psychiatrischen Diensten. Allein in der TAS Marburg wurden im Jahr 2024 rund 100 Patient*innen versorgt. Ein zentraler Bestandteil des Projekts ist die Anschubfinanzierung für medizinische Grundausstattung – darunter Verbandsmaterial, Medikamente oder die Einrichtung von Krankenzimmern. Auch Honorare und Aufwandsentschädigungen für freiwillig engagierte medizinische Fachkräfte, wie pensionierte Ärzt*innen oder Pflegekräfte, werden durch das Spendenprojekt übernommen.
2024 wurden etwa 4.000 Euro für Brillen aufgewendet, in diesem Jahr sind es bisher 1.800 Euro. Sonstige Ausgaben sind: Zuzahlungen Medikamente, Krankentransporte, Krankenhausaufenthalte, Zahnreinigungen, Wurzelbehandlungen, IGEL-Leistungen, die Klient*innen oft aus Unwissenheit abschließen, aber nicht bezahlen können. Mehr Informationen und Möglichkeit zu spenden
HINTERGRUND
Diakonie Hessen – Werk der Kirche, Mitgliederverband und Spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege
Die Diakonie Hessen ist als Werk der Kirche Mitglieder- und Spitzenverband für das evangelische Sozial- und Gesundheitswesen auf dem Gebiet der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) und der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW). In den Geschäftsstellen in Frankfurt am Main und Kassel, dem Evangelischen Fröbelseminar, sowie den Evangelischen Freiwilligendiensten arbeiten über 300 Mitarbeitende. Dazu kommen circa 520 Freiwillige, die sich in den verschiedenen Programmen des freiwilligen Engagements einbringen.
Der Diakonie Hessen gehören 439 Mitglieder an. Insgesamt sind bei der Diakonie Hessen und ihren Mitgliedern zusammen rund 45.000 Mitarbeitende beschäftigt, die im Geschäftsjahr 2022 einen Gesamtumsatz von über 2,5 Milliarden Euro erwirtschaftet haben.
Dem Vorstand des Landesverbandes gehören Pfarrer Carsten Tag (Vorstandsvorsitzender) und Dr. Harald Clausen an.
Sondervermögen Infrastruktur – Warum die Gesundheits- und Sozialwirtschaft jetzt zum Zuge kommen muss
Offener Brief an den Bundesfinanzminister

4.09.2025
Die aktuelle Verteilungsdebatte rund um das Sondervermögen lässt befürchten: Ausgerechnet diejenigen, die am dringendsten Hilfe brauchen, könnten am Ende leer ausgehen. Richtig wäre es, die Gesundheits- und Sozialwirtschaft in die Förderlogik des Sondervermögens einzubeziehen und dabei die Mittelvergabe an realen Bedarfen zu orientieren – ohne Unterscheidung nach kommunaler, freigemeinnütziger und konfessioneller Trägerschaft.
Dr. Susanne Eggert (JFF München) in Expertenkommission der Bundesregierung berufen

5.09.2025
(München/jff) – Expertenkommission „Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt“ vorgestellt | Leiterin Abteilung Forschung beim JFF München Dr. Susanne Eggert als ständiges Mitglied berufen | Kommission erarbeitet Strategie für den Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt"
Die
Bundesregierung hat die im Koalitionsvertrag angekündigte Expertenkommission „Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt“ eingesetzt, die ab Herbst 2025 eine Strategie für den Kinder- und
Jugendschutz in der digitalen Welt erarbeiten soll und dazu konkrete Handlungsempfehlungen für die zuständigen Akteure in Bund, Ländern und Zivilgesellschaft erarbeiten wird.
Bundesbildungsministerin Karin Prien stellte nun die 16 Mitglieder der Kommission vor.
EU-Mercosur-Handelsabkommen: Annahme durch die EU-Kommission gefährdet Menschenrechte und den Green Deal
3.09.2025
(Berlin/bfw) - Die
EU-Kommission will heute über die Annahme des Mercosur-Handelsabkommens entscheiden und es anschließend dem Rat der EU vorlegen. Eine Zustimmung würde den Ratifizierungsprozess einleiten. Das
Abkommen zwischen der EU und vier südamerikanischen Staaten gefährdet Regenwälder, Artenvielfalt, Klima und Menschenrechte. Überdies schafft es ein neues Klagerecht gegen die
Nachhaltigkeitsgesetze des europäischen Green Deals. Brot für die Welt fordert die EU-Kommission sowie den Rat der EU als auch das Europäische Parlament auf, den vorliegenden Vertragstext nicht
zu unterzeichnen. Dazu Sven Hilbig, Handelsexperte von Brot für die Welt:
„Man muss es ganz deutlich sagen: Das EU-Mercosur-Abkommen ist ein Rückschritt für die Menschenrechte, den Klimaschutz und die südamerikanische Wirtschaft. Das Abkommen verbietet
Exportbeschränkungen und baut Importzölle ab. Diese Maßnahmen begünstigen den Ausbau von Monokulturen, wie Soja, und den Bergbau in Südamerika. Das liegt nicht im Interesse Europas: Diese
Wirtschaftszweige sind maßgeblich dafür verantwortlich, dass Regenwälder zerstört und indigene Gemeinschaften vertrieben werden. Das Abkommen trägt nicht dazu bei, Armut und Arbeitslosigkeit zu
mindern. Selbst die Folgenabschätzung im Auftrag der Europäischen Kommission erwartet eine Schrumpfung der industriellen Produktion im Mercosur. ‘Partnerschaftsabkommen‘ ist daher ein
Etikettenschwindel für ein Abkommen, das die ökonomische Kluft zwischen der EU und dem Mercosur nur vertiefen wird. Wenn die EU-Kommission ihren eigenen Green Deal ernst nimmt, muss sie das
Abkommen ablehnen. Es ist eine schwere Hypothek für Klima und Menschenrechte.“
Erfahrungsaustausch zu KAB-Initiative „Faires Paket"
KAB Trier im Gespräch mit Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder

21.08.2025
Paketdienstbranche und Transportgewerbe im Fokus: Katholische Arbeitnehmer-Bewegung fordert bessere Arbeitsbedingungen für Paketzusteller und Trucker.
(Bitburg/bt) – Vertreter*innen der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) Trier haben sich am 18. August mit dem Bundesminister für Verkehr, Patrick Schnieder (CDU), zu einem intensiven Meinungsaustausch in dessen Wahlkreisbüro in Bitburg getroffen. Anne Basten, Ruth Mareien de Bueno und Andreas Luce nutzten die Gelegenheit, um auf die teils menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen in der Paketdienstbranche und im Transportgewerbe aufmerksam zu machen.
Im Mittelpunkt des Gesprächs standen die Erfahrungen aus der KAB-Initiative Faires Paket sowie die beiden Truckerstreiks in Gräfenhausen. Alle Beteiligten seien sich einig, so KAB-Bezirksgeschäftsführer Luce: „Die aktuellen Zustände sind nicht tragbar und erfordern dringend politische Maßnahmen."
Offenheit und Bekenntnis: Wie Kirche heute die Demokratie stärken kann

20.08.2025
(Dresden / eas) - Christen und Christinnen sind eine Minderheit in Ostdeutschland. Auch in Westdeutschland sinken die Mitgliederzahlen der großen Kirchen. Die Kirchen bleiben für die Demokratie dennoch wichtig, so die Direktor*innen der Evangelischen Akademien in Ostdeutschland.
Christen und Christinnen sind eine Minderheit in Ostdeutschland. Auch in Westdeutschland sinken die Mitgliederzahlen der großen Kirchen. Warum bleiben die Kirchen für die Demokratie dennoch wichtig? Wie können sie weiterhin ihren Beitrag für das Zusammenleben leisten? Und: Worin besteht dieser Beitrag?
Immer weniger Geburten – jetzt ist die Familienpolitik gefragt!
21.08.2025
Der Familienbund der Katholiken im Bistum Trier fordert angesichts der deutlich gesunkenen Geburtenrate, mit familienpolitischen Maßnahmen gegenzusteuern.
Inflationsanpassung beim Elterngeld dringend erforderlich - Elterngeld wurde seit Einführung im Jahr 2007 nicht mehr erhöht!
(Trier/mk) - „Die aktuellen Zahlen zeigen eine alarmierende Entwicklung: In Deutschland ist die Geburtenrate weiter gesunken. Von Januar bis April 2025 wurden 7,5 % weniger Kinder geboren als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Die durchschnittliche Kinderzahl pro Frau liegt inzwischen nur noch bei 1,35 – so niedrig wie seit über einem Jahrzehnt nicht mehr“, erklärt Gisela Rink, Vorsitzende des Familienbundes der Katholiken im Bistum Trier. Besonders besorgniserregend ist die wachsende Kluft zwischen Wunsch und Wirklichkeit: Während sich Paare in Deutschland weiterhin durchschnittlich 1,8 Kinder wünschen, bleibt die tatsächliche Kinderzahl deutlich darunter. Diese Entwicklung bedeutet nicht nur eine Einschränkung individueller Freiheit. Sie verschärft auch den Fachkräftemangel, erhöht den Druck auf das Rentensystem und hat langfristige Auswirkungen auf Wohlstand und gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Der Familienbund fordert daher verlässliche und flexible Rahmenbedingungen für Familien: „Wenn Eltern – je nach Lebenssituation – zwischen verschiedenen Modellen und Kombinationen von Erwerbstätigkeit, Kinderbetreuung und Erziehungsarbeit wählen können, ohne dadurch wirtschaftlich ins Hintertreffen zu geraten, entstehen echte Perspektiven für Familiengründung und -erweiterung. Eine moderne Familienpolitik muss dafür die Voraussetzungen schaffen“, so Rink.
Eine Maßnahme, die den Wunsch nach Kindern unterstützt, ist das Elterngeld. Laut der „Gesamtevaluation der ehe- und familienbezogenen Leistungen“ stieg die Geburtenzahl 2012 durch das Elterngeld um 7 %. Die Höhe des Elterngeldes wurde nach seiner Einführung Im Jahr 2007 nie an die Preissteigerungen angepasst und erfüllt seine Funktion als Lohnersatzleistung infolgedessen nur noch eingeschränkt. So hat der Mindestbetrag von 300 Euro 2007 noch das sächliche Existenzminimum eines Kindes abgedeckt. Dieses liegt mittlerweile bei über 500 Euro. Und der Höchstbetrag von 1.800 Euro begrenzt heute bereits bei Durchschnittseinkommen die eigentlich vorgesehene Lohnersatzrate von 65 %. Für viele Familien ist es daher finanziell nicht mehr möglich, dass auch die besserverdienende Person Elternzeit nimmt. Eine Inflationsanpassung ist daher beim Elterngeld dringend erforderlich, so Rink.
Um den Wunsch vieler Familien nach einer gleichmäßigeren Aufteilung von Erwerbs- und Familienarbeit zu unterstützen, fordert der Familienbund zusätzliche Partnermonate, wobei die von beiden Eltern flexibel nutzbaren zwölf Monate erhalten bleiben müssten. Die Flexibilität des Elterngeldes darf nicht eingeschränkt, sondern muss ausgebaut werden, auch durch die Möglichkeit eines Elterngeldbezugs in späteren Lebensphasen des Kindes. Damit das gewünschte Familienmodell auch nach dem Elterngeldbezug gelebt werden, braucht es zudem eine verlässliche, flexible und qualitativ hochwertige Betreuungsinfrastruktur, gute Bildung, familiengerechte Steuern und Sozialabgaben und eine besondere Förderung von Familien mit kleinen Einkommen.
Der Familienbund der Katholiken ist der mitgliederstärkste Familienverband Deutschlands.
Ihm gehören 25 Diözesan-, 10 Landes- sowie 15 Mitgliedsverbände an.
Internet: www.familienbund-trier.org
Schutz von Helfenden ist Grundlage für humanitäre Hilfe
383 Todesopfer weltweit in 2024: Gefährlichstes Jahr für humanitär Helfende

18.08.2025
(Berlin/dd) - Anlässlich
des Welttags der Humanitären Hilfe am 19. August fordert die Diakonie Katastrophenhilfe mehr Schutz und Achtung für den humanitären Sektor. „Das Jahr 2024 war besonders gefährlich für humanitäre
Helferinnen und Helfer weltweit. Unsere Partnerorganisationen in Gaza haben viele Mitarbeitende und Angehörige durch den Krieg verloren. Auch in Myanmar, in der Ukraine, in Haiti oder dem Sudan
arbeiten lokale Hilfsorganisationen unter immensen Risiken“, sagt Dagmar Pruin, Präsidentin der Diakonie Katastrophenhilfe.
Derzeit sind weltweit mehr als 300 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen. Um sie zu unterstützen, muss prinzipienorientierte humanitäre Hilfe respektiert und geschützt werden. „Wir
erleben jedoch in Krisen und Konflikten wiederholt, dass Helfende angegriffen und überfallen werden, oder ihnen der Zugang zu Notleidenden verwehrt wird“, beklagt Dagmar Pruin. „Der freie und
sichere Zugang zu den Menschen ist aber entscheidend.“
Hass im Netz: NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) fordert Umdenken der Justiz

„Vollbild“-Doku zeigt: Ein Kopfschütteln reicht, um zur Zielscheibe rechter Hass-Kampagne zu werden / Neue Folge ab Dienstag, 5. August 2025, in der ARD Mediathek
5.08.2025
(Mainz/Berlin/swr) - Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) fordert mit Blick auf die steigende Zahl an Hassbeiträgen im Internet ein Umdenken der Justiz. Im Interview mit dem SWR Investigativformat „Vollbild“ sagte er: „Ich hätte nichts dagegen, wenn sich in diesem Bereich das Bewusstsein ein wenig verändern würde, wenn man ein bisschen sensibler wäre.“ Heute müsse man sich vieles erlauben lassen, weil das Recht der freien Meinungsäußerung wichtiger sei.
Umsteuern jetzt! Brot für die Welt fordert mehr Mut statt Kürzungspolitik

Forderungen an Bundesregierung: Kürzungen im Entwicklungshaushalt zurücknehmen und globale Milliardärssteuer voranbringen // Spender*innen zeigen klare solidarische Haltung
31.07.2025
(Berlin/bfw) - Einen Tag nach dem Kabinettsbeschluss für den neuen Haushalt, der weitere Kürzungen für die Entwicklungszusammenarbeit vorsieht, warnt Dagmar Pruin, Präsidentin von Brot für die Welt, bei der Vorstellung des Jahresberichts in Berlin
eindringlich: „Diese erneuten Kürzungen bei der internationalen Zusammenarbeit sind vollkommen falsch und müssen zurückgenommen werden.
Sie gefährden Millionen Menschenleben. Die Erfolge der vergangenen Jahrzehnte bei der Armutsbekämpfung, der Ernährungssicherheit und insbesondere der Gesundheitsversorgung stehen auf dem Spiel.“ Nach dem Komplettrückzug der USA aus der Entwicklungszusammenarbeit und humanitären Hilfe, muss Deutschland eine Führungsrolle übernehmen und Initiativen zur internationalen Entwicklungsfinanzierung stärken – dazu gehört der Einsatz für eine globale Milliardärssteuer und die Entschuldung von Ländern des Globalen Südens.
Die Initiative „3. Oktober – Deutschland singt und klingt“ feiert am 30.07.2025 den Tag der Freundschaft

30.07.2025
(Berlin/Tutzing/sk) - seit dem Jahr 2011 gibt es den „Internationalen Tag der Freundschaft“ am 30. Juli offiziell und weltweit. Die Vereinten Nationen haben den Tag in jenem Jahr in ihre Liste aufgenommen. In Paraguay wird der Tag der Freundschaft bereits seit 1958 zelebriert, nachdem eine Gruppe ihn dort ins Leben gerufen hatte. Aber nicht nur Freundschaften zwischen Menschen werden am 30. Juli gefeiert, sondern auch die zwischen Kulturen und Ländern. Ein Gemeinschaftsgefühl, das die Initiative 3. Oktober – Deutschland singt und klingt gerne aufnimmt – trifft es doch im Kern unsere ureigenen Kernbotschaften für Freiheit, Einheit, Hoffnung sowie das Eintreten für den Frieden und die Demokratie.

Sozialer Wohnungsbau: Der Wohnungsmarkt steht unter großem Druck

28.07.2025
Bezahlbares Wohnen ist ein drängendes Thema. Das weiß auch die rheinland-pfälzische Finanzministerin Doris Ahnen. Sie hat ein soziales Bauprojekt in Trier besucht.
Von Rolf Lorig/Paulinus Wochenzeitung im Bistum Trier
(Trier/rl) - Auftakt der Reise zu verschiedenen Projekten, bei der sie von der Architektenkammer Rheinland-Pfalz, von Vertretern der Investitions- und Strukturbank (ISB) Rheinland-Pfalz sowie den Verbänden der sozial-orientierten Wohnungswirtschaft begleitet wurde, war Trier. Konkret ein Neubau mit 13 sozial geförderten Wohnungen der Aachener Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft in der Matthiasstraße.
Veröffentlichung der Dokumentation der Internationalen Wochen gegen Rassismus 2025

23.07.2025
(Darmstadt/iwgr) - Auch in diesem Jahr gibt es eine umfassende
Dokumentation der Internationalen Wochen gegen Rassismus. Sie enthält Best-Practice-Beispiele, eine Veranstaltungsauswertung, ein Fazit der Aktionswochen 2025 sowie einen Ausblick auf
2026.

Gesetzesentwurf zum Wehrdienst: Ist die Freiwilligkeit ernst gemeint?

16.07.2025
(Berlin/Düsseldorf/bdkj) - Nachdem das Nachrichtenmagazin Der Spiegel am 07.07.2025 Details aus dem Referent*innen-Entwurf zur Reform des Wehrdienstgesetzes berichtet hatte, nahm die gesellschaftliche Debatte über die Wiedereinsetzung der Wehrpflicht in Deutschland erneut Fahrt auf. Der BDKJ hat bereits im Herbst 2024 Stellung zum damaligen Entwurf aus dem Bundesverteidigungsministerium bezogen. Vor dem Hintergrund der Formulierungen des Koalitionsvertrags der Bundesregierung, „einen neuen attraktiven Wehrdienst, der zunächst auf Freiwilligkeit basiert“ zu schaffen, sowie dem Beschluss des Bundesparteitags der SPD Ende Juni 2025, bleiben dennoch viele Fragen offen.
„Noch bevor der Gesetzesentwurf überhaupt ins Kabinett eingebracht worden ist, beginnt aus unserer Sicht eine gesellschaftliche Debatte, deren Ziele nicht im Einklang mit den bisherigen Verlautbarungen der Bundesregierung stehen. Statt sich ernsthaft darum zu bemühen, die Freiwilligkeit im Wehrdienst sowie den Jugendfreiwilligendiensten und dem Bundesfreiwilligendienst jetzt zum Erfolg zu führen, konzentrieren sich gesellschaftliche und politische Akteur*innen auf Fragen der Umsetzung einer möglicherweise notwendigen Pflicht und beginnen präventiv die Freiwilligkeit zu unterminieren. Das setzt den Wert eines freiwilligen Engagements herab und schwächt das Vertrauen in den Umsetzungswillen der Regierung“, sagt BDKJ-Bundesvorsitzende Lena Bloemacher.
„Es braucht eine eindeutige Reaktion der Bundesregierung"
Kindermissionswerk ,Die Sternsinger’ und missio Aachen verurteilen israelischen Angriff auf Kirche in Gaza
18.07.2025
(Aachen/kmw) - Das Kindermissionswerk ,Die Sternsinger‘ und das katholische Hilfswerk missio Aachen verurteilen den heutigen israelischen Angriff auf eine katholische Kirche in Gaza-Stadt entschieden. Es soll mindestens zwei Tote und mehrere Verletzte geben. „Menschen, die in einer Kirche Schutz suchen zu bombardieren, stellt einen eklatanten Bruch internationalen Rechts dar und ist durch nichts zu rechtfertigen“, sagt Pfarrer Dirk Bingener, Präsident der beiden Aachener Hilfswerke. „Dieser Vorfall stellt einen weiteren Tiefpunkt im Handeln der israelischen Regierung dar. Es braucht eine eindeutige und spürbare Reaktion der Bundesregierung auf diese andauernden, inakzeptablen Vorfälle. Wir sind der immer gleichen Erklärungen und Rechtfertigungen der israelischen Regierung überdrüssig. Unsere Solidarität und unsere Gedanken sind bei den Opfern, ihren Angehörigen und allen, die unter den Folgen dieses Angriffs leiden. Wir beten für sie.“
Betroffen von dem Angriff war nach Informationen der Projektpartner der Aachener Werke die einzige katholische Kirche in Gaza, die Pfarrei der Heiligen Familie im Zentrum der Stadt. Auf dem Gelände der Pfarrei sollen rund 500 Flüchtlinge Schutz gesucht haben. Getötet wurden ein Gemeindearbeiter der Pfarrei und seine Mutter, der Gemeindepfarrer wurde verletzt.
Zuletzt unterstützte missio Aachen die Hilfe der katholischen Kirche in Gaza für Geflüchtete und Betroffene der Gewalt mit 100.000 Euro. Das Kindermissionswerk hatte jüngst eine Nothilfe zur Versorgung von 500 Familien mit Grundnahrungsmitteln in Gaza-Stadt in Höhe von rund 54.000 Euro bereitgestellt.
SOS-Kinderdorf: „Therapie? Frag doch deine Eltern!“
Bundestagspetition des Kinder- und Jugendrates von SOS-Kinderdorf
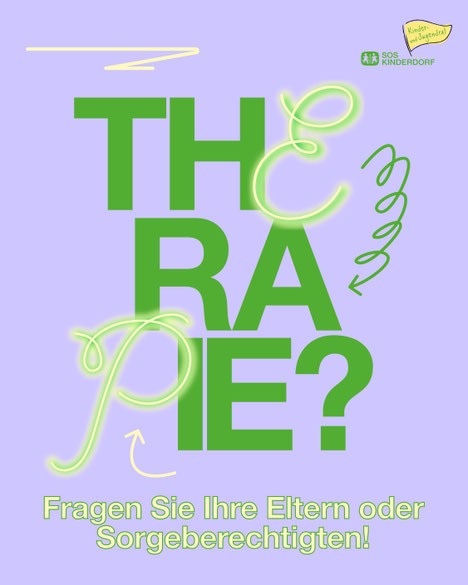
16.07.2025
Der SOS-Kinder- und Jugendrat aus aktuellen und ehemaligen SOS-Betreuten fordert in einer Petition beim Deutschen Bundestag ein Selbstbestimmungsrecht auf Psychotherapie.
(München/sos) - Laut UN-Kinderrechtskonvention haben Kinder das Recht auf das höchst erreichbare Maß an Gesundheit – und auf Beteiligung. Wollen sie jedoch eine Psychotherapie beginnen, hängt ihre mentale Gesundheit oftmals von der Zustimmung ihrer Sorgeberechtigten ab. Dass dies eine große Hürde sein kann, wissen vor allem junge Menschen aus der stationären Jugendhilfe: „Meine Mutter hat selbst schwere psychische Probleme, ich höre oft lange nichts von ihr. Als ich eine Therapie beginnen wollte, war sie einfach nicht erreichbar und ich musste daher lange auf professionelle Hilfe verzichten. Ich weiß, dass ich kein Einzelfall bin“, erklärt Alex*, 14, der in einer Wohngruppe von SOS Kinderdorf lebt. Der SOS-Kinder- und Jugendrat, der aus aktuellen und ehemaligen SOS-Betreuten besteht, fordert daher in einer Petition beim Deutschen Bundestag, dass einsichtsfähige junge Menschen selbst über den Start einer Therapie entscheiden dürfen. Die Petition „Therapiemöglichkeit für einsichtsfähige Kinder und Jugendliche ohne vorherige Zustimmung der Sorgeberechtigten“ kann bis 30.7.2025 unterzeichnet werden.
KDFB-Landesdelegiertenversammlung: Starke Signale für Frauenrechte und Demokratie
16.07.2025
(München/kdfb) - Bei der Landesdelegiertenversammlung des Katholischen Deutschen Frauenbundes (KDFB) am 12. Juli im Kardinal-Wendel-Haus in München fassten KDFB-Vertreterinnen aus ganz Bayern richtungsweisende Beschlüsse. Der KDFB ist Bayerns größter Frauenverband.
„Damit Neues geschehen kann, braucht es klare Visionen – und Frauen, die für politisches und demokratisches Engagement sensibilisiert und gestärkt werden. Angesichts der aktuellen politischen Entwicklungen müssen wir unsere Aktivitäten auf diesem Gebiet weiter intensivieren", betont KDFB-Landesvorsitzende Birgit Kainz.
Neue Projektgruppe „Frauen – Politik – Gesellschaft"
Der Landesverband wird 2026 eine Projektgruppe „Frauen – Politik – Gesellschaft" einrichten. Sie knüpft an das erfolgreiche Format „Starke Frauen – starke Demokratie" an und richtet sich ausdrücklich auch an Frauen, die kein offizielles politisches Amt anstreben, aber politisch mitdenken und mitgestalten wollen. Über zwei Jahre hinweg werden sich die Teilnehmerinnen vernetzen, gegenseitig inspirieren und Aktionen zu gesellschaftspolitischen Themen entwickeln. Der KDFB vernetzt damit seine Ebenen stärker miteinander, von der Basis bis zur Landesebene.
Zentrale Beschlüsse zu Gesundheit, Bildung und Frauenrechten
- Faire Hebammenvergütung: Der Landesverband wird sich für eine Nachverhandlung des zum 1. November 2025 geplanten Hebammenhilfevertrags einsetzen, um Umsatzverluste für Beleghebammen zu verhindern.
- Frauenrechte als verpflichtender Bildungsinhalt an weiterführenden Schulen: Der KDFB Bayern fordert, die Entwicklung der Frauenrechte verpflichtend als Lehrinhalt an weiterführenden Schulen zu verankern – vom Frauenwahlrecht bis zu aktuellen Gleichstellungsfragen.
- Erhalt der Familienpflegeausbildung in Bayern: Da in Bayern seit drei Jahren keine Ausbildung zur Familienpflegerin mehr möglich ist, fordern die KDFB-Delegierten, dass in Zukunft im Freistaat wieder entsprechende Ausbildungskurse angeboten werden.
Mit diesen Beschlüssen bekräftigt der KDFB Bayern sein Engagement für Frauen in allen Lebensbereichen sowie für eine lebendige Demokratie.
Als Bayerns größter Lobbyverband für Frauenrechte fördert der KDFB Landesverband Bayern seit 114 Jahren Geschlechtergerechtigkeit, Vielfalt und Solidarität in Kirche, Gesellschaft, Politik und Wirtschaft.
ADAC Stiftung kooperiert mit Nordrhein-Westfalen bei landesweiter Einführung von Reanimationsunterricht in Schulen

9.07.2025
Zweijährige konzeptionelle Zusammenarbeit / Unterstützung für die Qualifikation von Lehrkräften und bei der Ausstattung mit Unterrichtsmaterialien / Tillmann: „Gemeinsam stärken wir Kinder, im Notfall zu helfen.“
(Düsseldorf/adac) - Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen hat heute bekannt gegeben, Reanimationsunterricht verpflichtend in den Lehrplan aller weiterführenden Schulen aufzunehmen. Die ADAC Stiftung ist eine von mehreren Organisationen, die das bevölkerungsreichste Bundesland bei der Realisierung unterstützen. Die ADAC Stiftung hat seit rund zwei Jahren daran mitgearbeitet, das inhaltliche Konzept zu entwickeln. Für Schulungen der Lehrkräfte, eine begleitende Evaluation und Unterrichtsmaterialien stellt die ADAC Stiftung in den kommenden Jahren ihre inhaltliche Expertise und finanzielle Ressourcen zur Verfügung.
"Die christliche Botschaft ist total politisch”
Podcast „himmelwärts und erdverbunden“

7.07.2025
Malu Dreyer war 22 Jahre lang Sozialministerin und Ministerpräsidentin in Rheinland-Pfalz - ihrer Multiple-Sklerose-Erkrankung zum Trotz. Im Podcast „himmelwärts und erdverbunden“ erzählt sie, welche Rolle ihr Glaube dabei für sie gespielt hat – und welches Kirchenlied sie am liebsten singt.
Von Christopher Hoffmann
(Trier/ch) - 22 Jahre lang war Malu Dreyer ab 2002 zunächst Sozialministerin und dann Ministerpräsidentin in Rheinland-Pfalz – obwohl bereits 1995 bei ihr Multiple Sklerose diagnostiziert worden war. “Man verliert erst einmal komplett den Boden unter den Füßen,” schildert sie im Gespräch mit Christopher Hoffmann für den Podcast “himmelwärts und erdverbunden”. Dass sie weitermachen konnte, verdankt die Sozialdemokratin und bekennende Katholikin auch ihrem Glauben. Darüber erzählt sie; und auch, warum nach ihrer Überzeugung Kirche politisch sein muss. Und sie verrät, welches Kirchenlied sie am liebsten singt
Diakonie Katastrophenhilfe setzt auf Prävention und verlängert finanzielle Hilfen
9.07.2025
Jahrestag Ahrtalflut * Katastrophenvorsorge * Wiederaufbauhilfe * Spenden
(Berlin/Düsseldorf/dw) - Vier Jahre nach der Hochwasser- Katastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz setzt die Diakonie Katastrophenhilfe Rheinland-Westfalen-Lippe (RWL) verstärkt auf Prävention. Außerdem verlängert sie die Antragsfrist für finanzielle Wiederaufbauhilfen bis Ende 2025.
Die Diakonie Katastrophenhilfe Rheinland-Westfalen-Lippe bleibt auch vier Jahre nach dem verheerenden Hochwasser im Juli 2021 in den betroffenen Regionen und unterstützt die Menschen. In der täglichen Arbeit vor Ort rückt die Vorbereitung auf mögliche künftige Katastrophen in den Vordergrund. „Die Zahl der Gefährdungslagen in Deutschland nimmt zu. Die Ahrtalflut 2021 oder die Hochwasser in Süddeutschland im vergangenen Jahr sind nur die jüngsten Ereignisse.
Auf solche Szenarien müssen wir in Zukunft gut vorbereitet sein“, sagt Martin Keßler, Leiter der Diakonie Katastrophenhilfe. „Wenn wir dabei vorhandene lokale Strukturen nutzen, gelingt schnelle und passgenaue Hilfe erfahrungsgemäß am besten.“
„Als Diakonie-Familie können wir unsere Stärken optimal in die Katastrophenvorsorge einbringen“, bestätigt Kirsten Schwenke, Vorständin der Diakonie RWL. „Unsere Mitarbeitenden sind dauerhaft vor Ort, kennen die Region und die Menschen am besten und haben dabei auch immer deren Wohlbefinden im Blick.“
So auch beim Projekt „Soziale Gemeinschaften stärken“: Noch bis Ende September 2026 vereint es an zehn Standorten in der gesamten Hochwasserregion klassische Sozialarbeit in Quartieren mit Maßnahmen zur Katastrophenvorsorge und Klimafolgenanpassung. Das Ziel ist, die Menschen zu sensibilisieren und besser auf zukünftige Katastrophen wie Überschwemmungen oder lange Hitzeperioden vorzubereiten. „Je mehr Menschen vorbereitet sind und im Ernstfall eigenverantwortlich richtig handeln, desto besser“, sagt Markus Koth, der die Hochwasserhilfe bei der Diakonie Katastrophenhilfe koordiniert. „Dafür kooperieren unsere Quartiersprojekte mit den Kommunen, mit Fachleuten, Ehrenamtlichen und Katastrophenschutzorganisationen.“
Außerdem unterstützt die Diakonie Katastrophenhilfe RWL die Menschen weiterhin finanziell: Noch bis Ende des Jahres 2025 können vom Hochwasser Betroffene Anträge auf Unterstützung beim Wiederaufbau stellen. „Wir unterstützen Privatpersonen beim Wiederaufbau ihres selbst genutzten Eigenheims, das beim Hochwasser 2021 beschädigt oder zerstört wurde“, erklärt Markus Koth. „Unsere Hilfen sind eine Ergänzung, wenn staatliche Mittel und Versicherungsleistungen nicht ausreichen.”
In den vergangenen Jahren und Monaten konnten schon zahlreiche Hochwasser-Betroffene von der Wiederaufbau-Förderung profitieren. Bis Juni dieses Jahres wurden Anträge in Höhe von rund 8,5 Millionen Euro in dieser Förderlinie bewilligt und ausgezahlt. „Dennoch gibt es weiterhin Menschen, die noch keinen Antrag gestellt haben“, so Koth weiter. „Deshalb verlängern wir die Antragsfrist für diese Förderlinie bis zum 31. Dezember 2025.“
Vier Jahre nach der Hochwasserkatastrophe sind nahezu alle bei der Diakonie Katastrophenhilfe RWL eingegangenen Spendengelder in Höhe von
47,87 Millionen Euro ausgegeben oder für laufende Projekte fest verplant.
Weitere Hintergrundinformationen und Zahlen finden Sie auf der folgenden Website:
https://www.diakonie-rwl.de/themen/foerdermittel-und-spenden/hochwasser-nrw-und-rheinland-pfalz
UN-Expertin über Dalai Lama-Nachfolge: Keine Einmischung Chinas!
1.07.2025
(Genf/Berlin/ict) - Am Rande der aktuellen Sitzung des UN-Menschenrechtsrats hat die UN-Sonderberichterstatterin für Religionsfreiheit Nazila Ghanea die Einmischung Chinas in die Nachfolgefrage des Dalai Lama mit Nachdruck zurückgewiesen.
Ghanea erklärte in einem Videostatement bei einer Veranstaltung der Helsinki Foundation for Human Rights am vergangenen Freitag, 27. Juni: „Ich fordere die chinesische Regierung auf, sich nicht in die Identifizierung und Ernennung tibetischer buddhistischer Oberhäupter einzumischen, einschließlich einer zukünftigen Reinkarnation des derzeitigen Dalai Lama, die vom tibetischen Volk bestimmt werden muss." Ghanea forderte daneben die Rücknahme von entsprechenden Gesetzen, die von der chinesischen Regierung erlassen wurden, um eine umfassende Kontrolle über die Ernennung tibetischer Lamas durchzusetzen. Darüber hinaus müsse die chinesische Regierung den Aufenthaltsort des 1995 entführten Panchen Lama offenlegen.
Im Rahmen der gut besuchten Veranstaltung im Genfer Palais des Nations mit dem Titel „Religionsfreiheit und Einmischung in die Ernennung religiöser Geistlicher in Tibet" hoben Menschenrechtsverteidiger nachdrücklich die negativen religiösen, kulturellen und politischen Konsequenzen hervor, die von Chinas Bemühungen, den Reinkarnationsprozess tibetischer Lamas zu kontrollieren, ausgingen.
Tencho Gyatso, Präsidentin der International Campaign for Tibet (ICT), betonte in ihrer Erklärung:
„Der Dalai Lama ist nicht nur das spirituelle Oberhaupt des tibetischen Buddhismus, sondern auch das lebende Symbol der tibetischen Identität, Hoffnung und Resilienz. Der Anspruch der
Kommunistischen Partei Chinas, seine Nachfolge zu kontrollieren, ist eine eklatante Verletzung der Religionsfreiheit und ein Angriff auf die Seele der tibetischen Nation. Die internationale
Gemeinschaft muss jede politisch motivierte Einmischung in diese heilige Tradition entschieden zurückweisen."
Gloria Montgomery, Rechtsexpertin des Tibet Justice Center, unterstrich die völkerrechtlichen Relevanz des Vorgehens der chinesischen Regierung:
„Tibetische Buddhisten haben das Recht, ihre religiösen Oberhäupter selbst zu wählen – frei von staatlicher Einmischung. Dies ist ein Kernprinzip des Völkerrechts nach Artikel 18 des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte und der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Jeder Versuch der chinesischen Regierung, einen zukünftigen Dalai Lama zu ernennen oder zu kontrollieren, ist ein klarer Verstoß und muss von der internationalen Gemeinschaft unmissverständlich verurteilt werden."
Dr. Gyal Lo, tibetischer Bildungsexperte und ehemaliger Professor an der Südwest-Universität für Nationalitäten in Chengdu, beleuchtete eindringlich die systematische Indoktrination tibetischer Kinder in chinesischen Internaten:
„Der Versuch der chinesischen Regierung, die zukünftige Reinkarnation des Dalai Lama zu kontrollieren, muss im Zusammenhang mit ihrem Versuch gesehen werden, das Leben einer ganzen Generation tibetischer Kinder durch das koloniale Internatssystem zu kontrollieren. Es sind zwei Seiten derselben Medaille – zwei Hälften eines einzigen Plans – wovon eine darauf abzielt, Chinas Herrschaft in Tibet ein für alle Mal zu festigen, indem die kulturelle und spirituelle Kontinuität des tibetischen Volkes ausgelöscht wird."
Die Veranstaltung endete mit einem eindringlichen Aufruf an die UN-Mitgliedsstaaten, internationale Institutionen und die Zivilgesellschaft, eine klare Haltung gegen die chinesische Einmischung einzunehmen und das Recht des tibetischen Volkes auf religiöse und kulturelle Selbstbestimmung zu verteidigen. Am 2. Juli veranstaltet die Vertretung Großbritanniens beim Menschenrechtsrat ein Side-Event zum Thema "Freedom of religion or belief – Tibetan Buddhism". Zahlreiche Staaten treten dabei als Ko-Sponsoren der Veranstaltung auf. Am gleichen Tag will sich der Dalai Lama in einem Videostatement zur Frage seiner Nachfolge äußern.
Die vollständigen Statements im Original:
Transkript der Erklärung der UN-Sonderberichterstatterin Nazila
Ghanea
Erklärung von ICT-Präsidentin Tencho
Gyatso
Erklärung von Dr. Gyal Lo, Tibet Action
Institute
Erklärung von Gloria Montgomery,
Tibet Justice Center
Initiative „3. Oktober – Deutschland singt und klingt“
Noch 100 Tage bis zum deutschlandweiten Singen am 3. Oktober 2025

27.06.2025
(Berlin/Tutzing/sk) - Am 26. Juni 2025 sind es noch genau 100 Tage bis zum deutschlandweiten Singen am 3. Oktober 2025. Dieses Jahr feiern wir das 35. Jubiläum der Deutschen Einheit. Ein Tag, der uns daran erinnert wie viel wir erreicht haben und welche Stärke in der Einheit liegt. Es ist eine Zeit, in der wir zurückblicken und die historischen Ereignisse würdigen, die Deutschland aus einer geteilten Nation zu einer starken, vereinten Kraft gemacht haben. Das Motto "Miteinander in Einheit" symbolisiert nicht nur die politische Wiedervereinigung, sondern auch das soziale und kulturelle Zusammenwachsen. Es steht für das Miteinander der Menschen aus Ost und West und heute auch für das Zusammenwachsen verschiedenster Kulturen, die sich gegenseitig unterstützen und bereichern. Die Einheit hat uns gelehrt, dass Vielfalt eine Quelle der Stärke ist und dass durch Zusammenarbeit und gegenseitiges Verständnis große Dinge erreicht, werden können.
IB lädt zu seinem dritten Kongress: „Zusammen! Für Vielfalt, Teilhabe und Demokratie!“
26.06.2025
Austausch zu Bildung, sozialer Arbeit, Jugendbeteiligung und mehr – Mitgliederversammlung direkt im Anschluss
(Frankfurt am Main/ib) - Unter dem Motto „Zusammen! Für Vielfalt, Teilhabe und Demokratie“ lädt der Internationale Bund (IB) für den 12. September 2025 zu seinem dritten Kongress ein. In Zeiten zunehmender gesellschaftlicher Spannungen und Polarisierung fördert der freie Träger der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit den fachlichen Austausch – für eine gerechte, vielfältige und demokratische Gesellschaft. Der Kongress findet im hybriden Format statt – Veranstaltungsort ist Berlin, eine Online-Teilnahme ist möglich.
Demokratie ist kein Märchen, sie lebt vom Mitmachen!
Ein Höhepunkt der Veranstaltung ist die Keynote von Dr. Ronen Steinke, leitender Redakteur im Politikressort der Süddeutschen Zeitung. Unter dem Titel „Wenn ihr wollt, ist es kein Märchen – Demokratie, die funktioniert“ beleuchtet er, wie demokratische Strukturen erhalten und gestärkt werden können.
Neben Steinke bringen zahlreiche Fachleute aus Praxis, Wissenschaft und Wirtschaft ihre Perspektiven ein. Im Fokus stehen unter anderem die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, der Fachkräftemangel sowie die Rahmenbedingungen für Bildung und soziale Arbeit. Die Online-Teilnahme am IB-Kongress ist kostenfrei und steht allen Interessierten offen – das Organisationsteam bittet jedoch um Anmeldung.
„Mit den vergangenen IB-Kongressen haben wir den Dialog über gesellschaftsrelevante Themen für ein breiteres Publikum geöffnet. Der diesjährige Kongress schafft Raum für neue Perspektiven, gemeinsames Lernen und gelebte Teilhabe – und das ist angesichts der aktuellen Entwicklungen wichtiger denn je “, sagt IB-Präsidentin Petra Merkel. „In schwierigen Zeiten sich nicht zurückziehen – sondern mitmachen!“
Eine Mitgliedschaft im Internationalen Bund eröffnet nicht nur die Möglichkeit zur Live-Teilnahme am Kongress, sondern auch zur Mitwirkung an der anschließenden Mitgliederversammlung am 13. September. Dort können Mitglieder Einblicke in die Arbeit des IB gewinnen und Entwicklungen aktiv mitgestalten. Weitere Informationen zur Mitgliedschaft gibt es hier.
Über den Internationalen Bund (IB):
Der Internationale Bund (IB) ist mit mehr als 14.000 Mitarbeitenden einer der großen Dienstleister in der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit in Deutschland. Er unterstützt Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren*Seniorinnen dabei, ein selbstverantwortetes Leben zu führen – unabhängig von ihrer Herkunft, Religion oder Weltanschauung. Sein Leitsatz „Menschsein stärken“ ist für die Mitarbeiter*innen Motivation und Orientierung.
Internationale Zusammenarbeit: Deutschland muss seine Versprechen halten
24.06.2025
(Berlin/bfw) - Zur Vorlage des Kabinettsentwurfs zum Bundeshaushalt 2025 sowie zum Eckwertebeschluss für 2026 sagt Dagmar Pruin, Präsidentin von Brot für die Welt und Diakonie
Katastrophenhilfe:
„Weltweit steigt die Zahl der Krisen, die Not der Menschen wird größer.
Gerade jetzt muss die Bundesregierung Werte wie Solidarität und Menschlichkeit in den Mittelpunkt ihres Handelns stellen - die Mittel für die internationale Zusammenarbeit zu kürzen, steht hierzu im krassen Widerspruch. Wir dürfen uns nicht damit abfinden, dass weltweit
300 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen sind und sogar
800 Millionen Menschen hungern.
Durch den Ausfall von USAID fehlen vorerst jährlich über 50 Milliarden US-Dollar für die Unterstützung der Länder des Globalen Südens – andere wohlhabende Länder sind dem schlechten Beispiel der US-Regierung gefolgt. Deutschland muss zu seinen internationalen Versprechen stehen und damit ein positives Vorbild sein, um zu zeigen: Man lässt keinen Menschen verhungern!“
Iran: Mullah-Regime geht gehen Kurden und Oppositionelle vor
(Göttingen/gfbv) - Angesichts der andauernden Eskalation zwischen Israel und dem Iran ist die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) in großer Sorge über die wachsende Gefahr neuer Angriffe des Mullah-Regimes auf Kurden im Westen des Landes sowie auf die iranische Opposition. „In den mehrheitlich kurdischen Gebieten hat das Regime seine Truppen verstärkt, insbesondere an der Grenze zu Irakisch-Kurdistan. Zwischen den kurdischen Ortschaften, aber auch innerhalb der Dörfer, wurden vielerorts Checkpoints der Revolutionsgarden und der Armee eingerichtet. Diese werden vom iranischen Regime genutzt, um gegen Kurden und Oppositionelle vorzugehen“, berichtete der GfbV-Nahostreferent Dr. Kamal Sido heute in Göttingen. Das Regime befürchtet, dass die Kurden ihren seit Jahren geführten Kampf für Demokratie und Selbstbestimmung nun intensivieren könnten.
Nach Informationen der GfbV-Partnerorganisation „Hengaw“ wurden landesweit mindestens 150 Anklagen gemeldet. Die Anklagebegründungen reichen von „Spionage für Israel“ und „Störung der öffentlichen Meinung“ über „Medienunterstützung für Israel“ und „Schüren von Unruhen“ bis hin zu „Sicherheitskooperation mit dem Feind“, „Besitz von Sprengstoff oder Drohnen“ und „Beleidigung der Märtyrer“. Betroffen sind demnach Menschen in den Provinzen und Städten Ardabil, Baneh, Fashafouyeh, Golestan, Hormozgan, Ilam, Isfahan, Kerman, Lali, Lorestan, Mazandaran, Savojbolagh, Semnan, Shahrekord und in der Hauptstadt Teheran.
Hinsichtlich der aus den westlichen NATO-Ländern laut werdenden Forderungen nach einer Militärintervention, um das Regime zu stürzen, mahnt die GfbV zur Vorsicht. „Die iranische Bevölkerung wünscht sich zwar die Abschaffung der Diktatur, hat aber gleichzeitig Angst vor Chaos, einem langjährigen Bürgerkrieg und dem Austausch des Mullah-Regimes durch eine andere Diktatur. Um einen demokratischen Wandel zu unterstützen, sollten westliche Staaten demokratischen Oppositionsgruppen und Minderheiten wie den Kurden im Iran zur Seite stehen. Militärische Interventionen ohne ein klares Konzept für die Demokratisierung und die Schaffung föderaler Strukturen haben weder in Afghanistan noch in Syrien zu mehr Freiheiten für alle Menschen geführt“, mahnt der Menschenrechtler. Wichtig sei, dass es ein klares, realistisches Konzept der Opposition für die Zeit nach dem Mullah-Regime gebe, um Ängsten und Unsicherheit in der Bevölkerung entgegenzuwirken.
Die NATO-Regierungen sollten laut dem Nahostexperten insbesondere auf ihren Partner Türkei einwirken, der wie im Falle Syriens, der Ukraine und des israelisch-arabischen Konflikts auch im Iran versuche, eigene Interessen durchzusetzen. „Viele Kurden vermuten, dass die Türkei im Iran dasselbe Ziel verfolgt wie in Syrien: Kurden daran zu hindern, Autonomie zu erlangen. Die Türkei verurteilt zwar öffentlich die israelischen Angriffe auf den Iran, schmiedet aber gleichzeitig Pläne, um sich militärisch einzumischen“, so die Einschätzung des Nahostexperten. „Die Türkei muss daran gehindert werden, im Iran mithilfe radikaler Kräfte einen Krieg gegen die kurdische Bevölkerung zu führen. Ein solches Eingreifen würden das Leben des Regimes im Iran nur verlängern und Hass sowie Feindseligkeiten unter den Menschen und Völkern des Iran schüren“, mahnt Dr. Sido.
Von den rund 90 Millionen Menschen im Iran sind mindestens elf Millionen Kurden. Sie stellen nicht nur in der offiziellen Provinz Kurdistan, sondern auch in einigen anderen westlichen Provinzen des Landes die Mehrheit. Ihre Heimat bezeichnen sie als „Ost-Kurdistan“. Gegenüber dem seit dem Sturz des Schahs regierenden schiitischen Mullah-Regime herrscht großes Misstrauen. Die Mullahs hatten der kurdischen und anderen Volksgruppen Demokratie und Autonomie versprochen. Dieses Versprechen haben sie jedoch nicht eingelöst. Demokratie und Föderalismus sind daher nach wie vor die Hauptforderungen der Kurden im Iran. Die Kurden sind in einigen Parteien organisiert und verfügen über bewaffnete Verbände.
10 Jahre Laudato Si’ – Klimagerechtigkeit ist Geschlechtergerechtigkeit
17.06.2025
(Köln/kdfb) – Am 18. Juni 2015 rief Papst Franziskus in seiner Enzyklika Laudato Si’ eindringlich zur Bewahrung der Schöpfung und zu globaler Solidarität auf. Anlässlich dieses Jubiläums bekräftigt der Katholische Deutsche Frauenbund e.V. (KDFB) seine Forderung nach einer Klima- und Sozialpolitik, die Geschlechtergerechtigkeit als eine zentrale Voraussetzung für Klimagerechtigkeit anerkennt und umsetzt.
„Eine solidarische, nachhaltige Zukunft ist ohne Geschlechtergerechtigkeit nicht denkbar“, betont Monika Arzberger, Vizepräsidentin des KDFB. Frauen sind weltweit besonders stark von den Folgen der Klimakrise betroffen, sei es durch Ernteausfälle, Wasserknappheit oder klimabedingte Konflikte. Gleichzeitig sind sie entscheidende Akteurinnen für eine nachhaltige und gerechte Zukunft. Der KDFB fordert eine feministische Klimapolitik, die den Kampf gegen den Klimawandel mit der Förderung von Geschlechtergerechtigkeit verbindet.
Daher fordert der KDFB die Verankerung des Nachhaltigkeitsprinzips im Grundgesetz als verbindlichen Maßstab deutscher Politik und Gesetzgebung. Die enge Verbindung zwischen Klimawandel, Konflikten und Geschlechtergerechtigkeit muss klar anerkannt werden. Weltweit gilt es, Frauen als Akteurinnen für den Klimaschutz und Anpassungsstrategien zu stärken sowie ihre Teilhabe an klimapolitischen Entscheidungsprozessen zu sichern.
Auch wirtschaftliche Strukturen müssen stärker in den Blick genommen werden: Unternehmen in Deutschland sollen verpflichtet werden, Sorgfaltspflichten entlang der gesamten Wertschöpfungskette umzusetzen. Auf europäischer Ebene fordert der KDFB ein wirksames Lieferkettengesetz. Zentral für globale Gerechtigkeit sind zudem faire Handelsbedingungen sowie die Förderung einer umweltverträglichen, standortgerechten Landwirtschaft. Der Schutz bäuerlicher Strukturen und die Begrenzung von Boden- und Lebensmittelspekulationen sind dabei ebenso unerlässlich wie kurzfristige Maßnahmen zur CO₂-Reduktion.
Laudato Si’ hat bereits 2015 deutlich gemacht, dass die Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen ein zentraler Beitrag zu globaler Gerechtigkeit und Frieden ist. Der KDFB versteht dieses Anliegen als bleibenden Auftrag: „Als Christinnen sehen wir uns in der Verantwortung, gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft einzutreten. Wir tragen Mitverantwortung dafür, kommenden Generationen eine Welt zu hinterlassen, in der sie gut und würdig leben können – in Solidarität mit allen Menschen, weltweit und über alle Unterschiede hinweg“, so Arzberger abschließend.
Die Deutsche Aidshilfe fordert: Schluss mit sexualfeindlicher Zensur in sozialen Medien
Die Politik muss endlich klare Regeln festlegen
17.06.2025
(Berlin/dah) - Die Videoplattform Youtube hat Anfang Juni ohne Vorwarnung den Kanal von ICH WEISS WAS ICH TU (IWWIT) gelöscht. Der Rauswurf der Präventionskampagne der Deutschen Aidshilfe (DAH) für schwule Männer und andere queere Menschen erfolgte pünktlich zum Beginn des Pride Months Juni – Hochsaison für Prävention und Zeit der Demonstrationen gegen Ausgrenzung, für queere Sichtbarkeit.
„Die Löschung unseres Kanals zu Beginn der CSD-Saison ist ein Schlag ins Gesicht der queeren Community. Youtube schadet damit der Gesundheit vieler Menschen. Aufklärung über HIV und andere sexuell übertragbare Infektionen lebt davon, dass wir in der Öffentlichkeit offen und wertschätzend über Sexualität sprechen können“, sagt Winfried Holz vom Vorstand der Deutschen Aidshilfe.
Staatlich finanzierte Prävention
YouTube begründet den Schritt in einer Standardmail mit Verstößen gegen die YouTube-Richtlinien zu „Sex und Nacktheit“. Weder gab es vorher Beanstandungen einzelner Inhalte, noch eine Vorwarnung. Im Kanal waren keinerlei pornografische oder sonstwie anstößige Inhalte zu sehen. Wo von Sexualität die Rede und nackte Haut zu sehen war, diente dies dem Zweck der Prävention – auf Basis wissenschaftlicher Grundlagen.
Die Inhalte der Präventionskampagne werden in der Regie der Deutschen Aidshilfe von schwulen Männern und anderen queeren Menschen selbst produziert. Die Kampagne wird über das Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit (BIÖG) gefördert und mit diesem fachlich abgestimmt.
Trauriger Höhepunkt der Sexualfeindlichkeit
Die Löschung des YouTube-Kanals von ICH WEISS WAS ICH TU ist ein trauriger Höhepunkt einer sexualfeindlichen Politik der großen Social-Media-Konzerne aus den USA. Was mit Sex zu tun hat, wird gnadenlos geblockt und gelöscht. Organisationen, die über Sexualität aufklären, sind schon lange gezwungen, ihre Inhalte zu chiffrieren, etwa durch kreative Schreibweisen oder mehrdeutige Emoticons.
„Unter diesen Bedingungen ist es fast unmöglich, lebensnahe Prävention zu machen. In unserer Arbeit greifen wir die Realität unserer Zielgruppen auf, sprechen klar und deutlich über Sex, Schutzstrategien und Gesundheit und ermutigen zu einem selbstbewussten Umgang mit der eigenen Sexualität. Dabei stoßen wir ständig an die Grenzen von Google, Meta und Co. Es kann nicht sein, dass gesundheitliche Aufklärung in Deutschland von den moralischen Vorstellungen US-amerikanischer Konzerne abhängt“, erklärt DAH-Vorstand Winfried Holz.
Hass ist ok, Sexualität gefährlich
Während Inhalte zum Thema Sexualität schnell zensiert werden, bleiben diskriminierende Äußerungen, etwa gegen queere Menschen, oft stehen. Menschenfeindlichkeit wird geduldet und mit Meinungsfreiheit begründet. Verschärft hat sich dieses Problem seit Beginn der zweiten Amtszeit Donald Trumps. So hat etwa Meta Moderationsregeln zum Schutz vor Minderheitenfeindlichkeit stark gelockert.
„In der Summe wird die fatale Botschaft vermittelt: Hass ist okay, Sexualität ein No-Go. In einer offenen, demokratischen Gesellschaft müsste es umgekehrt sein. Hier ist die Politik gefragt: Wir brauchen klare Gesetze, die freie Rede ermöglichen, ihr aber genau dann Grenzen setzen, wenn das Wohl anderer Menschen gefährdet ist“, so Holz.
Offener Brief an Youtube
Die Deutsche Aidshilfe hat Youtube in einem offenen Brief aufgefordert, den Kanal umgehend wiederherzustellen. Beanstandungen müssen transparent, offen und begründet erfolgen – nicht pauschal und ohne Möglichkeit, Stellung zu beziehen.
Gerechtigkeit im Bildungssystem?
Das SchulSachsenSofa zur Schulpolitik am 16. Juni in Großenhain

Mit Kultusminister Conrad Clemens, Prof. Dr. Anke Langner und Schulsozialarbeiter Christian Ruffert
Montag,
16. Juni 2025 | 15:00 Uhr
Berufliches Schulzentrum Großenhain
Informationen: www.sachsensofa.de
11.06.2025
(Dresden/kabdm) - Bildung soll stärken, fördern und Wege eröffnen – doch für viele junge Menschen ist Schule vor allem eines: Stress. Zwischen Notendruck, Prüfungsangst und starren Bewertungssystemen bleibt oft wenig Raum für individuelles Lernen, Kreativität oder persönliche Entwicklung. Wie gerecht ist unser Bildungssystem wirklich – und was macht der ständige Leistungsdruck mit den Schülerinnen und Schülern?
Gerade in Sachsen steht Schulpolitik immer wieder im Fokus öffentlicher Debatten – nicht zuletzt wegen Lehrkräftemangel, hoher Unterrichtsverpflichtungen und wachsender Anforderungen im Schulalltag. Der Druck ist nicht nur auf Seiten der Lernenden groß, sondern betrifft ebenso Lehrerinnen und Lehrer, die zwischen Lehrplänen, Leistungsanforderungen und individuellen Bedürfnissen jonglieren müssen.
Familienbund im Bistum Trier kritisiert Abschaffung der Familienreservierung bei der Deutschen Bahn
16.06.2025
(Trier/bt) – Der Familienbund der Katholiken im Bistum Trier äußert scharfe Kritik am Aus der Familienreservierung bei der Deutschen Bahn. Gisela Rink, Vorsitzende des Familienbundes, erklärt: „Die neuen seit heute geltenden Reservierungskosten werden das Bahnfahren für alle Familien empfindlich teurer machen. Ich würde es sehr begrüßen, wenn die Verantwortlichen ihre Pläne noch einmal überdenken. Preiserhöhungen speziell zu Lasten von Familien passen überhaupt nicht in die Zeit.“
Der Familienbund betont, dass es problematisch sei, wenn die Bahn Sitzplatzreservierungen für Familien erheblich verteuere. „Wenn Eltern mit ihren Kindern Bahn fahren, sind sie auf eine Reservierung angewiesen, damit alle zusammen sitzen können. Gerade in der Ferienzeit sind die Züge voll“, so Rink weiter. „Die Bahnfahrt zu den Großeltern oder in den Urlaub darf nicht an zu hohen Kosten scheitern.“ Sie fordert die Politik und den Bund auf, umweltfreundliches Reisen mit der Bahn auch für Familien preislich attraktiver zu gestalten. „Insbesondere bei Reisen mit der Familie sind die Kosten gegenüber dem Auto ein wichtiges Entscheidungskriterium“, erklärt Rink.
Mit der Abschaffung der Familienreservierung, die ab diesem Sonntag wegfällt, steigen die Kosten für Familien deutlich. Eltern müssen künftig für jedes Kind einen Sitzplatz bezahlen, statt wie bisher für bis zu fünf Personen 10,40 Euro zu zahlen. In der zweiten Klasse erhöht sich der Preis für eine Reservierung um 30 Cent auf 5,50 Euro, in der ersten Klasse kostet der feste Platz künftig 6,90 Euro statt 6,50 Euro.
„Für Familien wird das Bahnfahren mit reservierten Plätzen dadurch deutlich teurer“, so Rink. „Anstelle der 10,40 Euro für eine Familienreservierung in der zweiten Klasse sind es mit zwei Kindern künftig 22 Euro. Für Hin- und Rückweg kommen 44 Euro zusammen – nur für Reservierungen.“
Gisela Rink abschließend: „Wir fordern die Verantwortlichen auf, ihre Pläne noch einmal zu überdenken und eine Lösung zu finden, die Familien nicht finanziell belastet. Das Bahnfahren soll auch weiterhin eine umweltfreundliche und bezahlbare Alternative für Familien bleiben.“
Gedenkveranstaltung zum Jahrestag des Volksaufstandes vom 17. Juni 1953 in Leipzig
14.06.2025
Der Volksaufstand vom 17. Juni 1953 gegen die kommunistische Diktatur in der DDR ist ein zentrales Datum der deutschen Demokratiegeschichte. Nur wenige Jahre nach dem Ende der NS-Diktatur und der kurze Zeit später im Osten Deutschlands errichteten kommunistischen Diktatur gingen die Menschen in fast 700 Orten für Freiheit, Demokratie und Deutsche Einheit auf die Straße. Das Eingreifen der sowjetischen Besatzungsmacht und der Deutschen Volkspolizei schlugen diesen friedlichen Aufstand blutig nieder.
(Leipzig/re) - Wie in jedem Jahr lädt das Bürgerkomitee Leipzig e.V. in Kooperation mit der Vereinigung der Opfer des Stalinismus (VOS) und anderer Verfolgtenverbände am 17. Juni 2025, 16.00 Uhr, anlässlich des 72. Jahres-tages des Volksaufstandes vom 17. Juni 1953 zu einer Gedenkveranstaltung mit Kranzniederlegung ein.
Gedenkveranstaltung mit Kranzniederlegung und Schweigeminute
Das Bürgerkomitee Leipzig e.V. lädt in Kooperation mit der Vereinigung der Opfer des Stalinismus (VOS) und anderer Verfolgtenverbände sowie in Zusammenarbeit mit der Stadt Leipzig am 17. Juni 2025, um 16.00 Uhr, anlässlich des 72. Jahrestages des Volksaufstandes an der Gedenktafel in der Straße des 17. Juni zum Gedenken an die Opfer des 17. Juni 1953 ein.
Nach einem Grußwort des Leiters der Gedenkstätte Museum in der „Runden Ecke“, Tobias Hollitzer, wird der Direktor des Stadtgeschichtlichen Museums der Stadt Leipzig in diesem Jahr die Gedenkrede halten. Der Volksaufstand ist ein wichtiger Teil der jüngsten Leipziger Stadt- und Demokratiegeschichte. Im Anschluss wird Christian Dertinger, ein Zeitzeuge des 17. Juni 1953, schildern, wie er den Volksaufstand erlebt hat. Musikalisch umrahmt wird die Kranzniederlegung von den Leipziger Blechbläsersolisten.
Das Vermächtnis des Volksaufstandes ist aktueller denn je
In der DDR wurde der Aufstand als ein vom Westen gesteuerter faschistischer Putschversuch diffamiert, so dass ein angemessenes Gedenken erst nach der Friedlichen Revolution möglich wurde. Auch wenn der Volksaufstand vom 17. Juni 1953 gegen die kommunistische Diktatur nunmehr schon 72 Jahre zurückliegt, müssen wir immer wieder daran erinnern und uns dieser Geschichte vergewissern. Denn Freiheit und ein demokratischer Rechtsstaat sind nicht selbstverständlich. Sie müssen immer wieder hart erkämpft und verteidigt werden.
Dies zeigt auch der seit inzwischen über drei Jahre andauernde völkerrechtswidrige Vernichtungskrieg Russlands gegen die Ukraine, in dem das ukrainische Volk seine Freiheit und ein Leben auf Basis einer demokratischen Werteordnung gegen Putins postsowjetische Diktatur verteidigt. Der Aufstand für eine demokratische und europäische Ukraine 2014 auf dem Maidan in Kiew wurde ebenso als faschistisch diskreditiert wie der KGB-Mann Putin heute noch behauptet, die Ukraine von Faschisten befreien zu müssen.
Aktive Erinnerung an den Volksaufstand vom 17. Juni 1953 und seine Opfer ist für die Gestaltung unseres demokratischen Rechtsstaates unverzichtbar
Seit 1945 gab es Widerstand gegen die Errichtung einer kommunistischen Diktatur im sowjetisch besetzten Teil Deutschlands, der einen ersten Höhepunkt in den Protesten vor 72 Jahren fand. Vom 16. bis 21. Juni 1953 kam es in fast 700 Städten und Gemeinden der damaligen DDR zu Demonstrationen und Streiks von insgesamt mehr als einer Million Menschen. In Leipzig legten am 17. Juni insgesamt 27.000 Arbeiter und Angestellte in über 80 Betrieben die Arbeit nieder. Am Nachmittag demonstrierten bereits über 40.000 Menschen auf verschiedenen Routen durch Leipzig. Schon damals waren „Deutsche Einheit“ und „Freie Wahlen“ zentrale Forderungen des friedlichen Protestes. So zeigte sich in diesem ersten antidiktatorischen Aufstand im kommunistischen Machtbereich das Streben der Menschen in der DDR nach Demokratie und Freiheit, das schließlich am militärischen Eingreifen der sowjetischen Besatzungsmacht scheiterte.
Mit dem Einsatz von Schusswaffen und der Verhängung des Ausnahmezustandes wurden alle Hoffnungen auf Veränderungen zerstört. Neun Tote und mindestens 95 Verletzte waren allein im Bezirk Leipzig zu beklagen. Unmittelbar nach dem Aufstand setzte eine große Verhaftungswelle ein. Von den durch Stasi und Volkspolizei in Leipzig fast 1.000 Verhafteten wurden in den Folgemonaten über 100 Personen – teils in Schauprozessen – zu langjährigen Haftstrafen verurteilt, einer durch ein sowjetisches Militärtribunal (SMT) auch zum Tode.
Es folgten die Volksaufstände in Ungarn 1956 und der CSSR 1968, die Solidarnosz-Bewegung in Polen der 1980er Jahre und schließlich die Revolutionen, die 1989 die kommunistischen Regime in Osteuropa zu Fall brachten. Am 17. Juni 1953 mißlang das, was am 9. Oktober 1989 vollendet werden konnte.
Ein bewusstes Erinnern an den Volksaufstand und seine Opfer war in der DDR nicht möglich. Während die Bundesrepublik den 17. Juni zum gesetzlichen Feiertag und später zum nationalen Gedenktag erklärte, wurde er vom SED-Regime bis zum Schluss als „faschistischer“ bzw. „konterrevolutionärer Putschversuch“ diffamiert. Seit der Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 wurde der bisherige Nationalfeiertag in Westdeutschland vom 17. Juni auf den 3. Oktober gelegt. Der 17. Juni scheint jenseits runder Jubiläen zunehmend in den Hintergrund und damit in Vergessenheit zu geraten. Dies darf nicht passieren! Denn gerade dieser friedliche Aufstand für Freiheit und Demokratie gegen die kommunistische Diktatur zeigt eindrücklich, wie unerlässlich die 1989 erworbene Demokratie und Freiheit sind und dass wir uns für deren Erhalt immer wieder besonders auch in der Gegenwart einsetzen müssen.
Leipzig hat heute drei Gedenkorte an die Opfer des Volksaufstandes
Da ein angemessenes Gedenken erst nach der Friedlichen Revolution möglich wurde, erinnert erst seit 1994 in der Straße des 17. Juni eine Gedenktafel am Eingang der ehemaligen Haftanstalt, also an jenem Ort, an dem es zum ersten Todesopfer des Aufstandes kam, an die „Opfer 1933–1945 und 1945–1989“. Im Jahr 2003 wurden zwei Bronzeabdrücke von Panzerketten ebenerdig in den Boden des Salzgässchens am Markt eingelassen, um an die militärische Niederschlagung des Volksaufstandes zu erinnern. Vor einigen Jahren wurde die 1994 installierte Grab- und Gedenkanlage für die „Opfer kommunistischer Gewalt 1945-1989“ auf dem Leipziger Südfriedhof aufgewertet.
Allerdings liegt dieser Gedenkort für die Opfer der Gewaltherrschaft von 1945 bis 1989, auf dem auf kleinen Granitplatten auch die Namen der Toten des 17. Juni 1953 verzeichnet sind, unscheinbar am äußersten Rand des großen Friedhofs. An zentraler Stelle aber findet sich auf demselben Friedhof noch heute der ehemalige sozialistische Ehrenhain, in dem an SED-Funktionäre erinnert wird, darunter auch die ersten beiden Stasi-Chefs von Leipzig.
Gerade in der heutige Zeit, in der Freiheit und Bürgerrechte sowie ein demokratischer Rechtsstaat immer wieder auch hinterfragt und angegriffen werden, ist eine aktive Erinnerung und positive Verankerung dieses herausragenden Ereignisses der Leipziger Demokratiegeschichte von großer Bedeutung.
http://www.runde-ecke-leipzig.de
3.06.2025
(Berlin/bfw) - Demokratie und Menschenrechte geraten weltweit zunehmend in die Defensive, auch weil rechtsstaatliche Prinzipien immer weiter untergraben werden. Das belegt der achte Atlas der Zivilgesellschaft, den Brot für die Welt heute veröffentlicht. Mehr als
85 Prozent der Weltbevölkerung ‒ etwa sieben Milliarden Menschen ‒ leben aktuell in Ländern, in denen Regierungen und andere Akteur*innen die Handlungsräume für Zivilgesellschaft beschränken, unterdrücken oder komplett geschlossen haben. Der Atlas der Zivilgesellschaft mit dem Schwerpunktthema „Angriffe auf den Rechtsstaat“ untersucht, wie Regierungen rechtsstaatliche Mechanismen missachten, manipulieren und aushöhlen, um Grundlagen für die Repression der Zivilgesellschaft zu schaffen. Er zeigt aber auch, wie zivilgesellschaftliche Organisationen bestehendes Recht nutzen, um etwa im Rahmen von strategischen Klagen und Prozessen sozialen und ökologischen Fortschritt voranzutreiben.
Deutschland zählt wie schon voriges Jahr zur Kategorie „beeinträchtigt“, der zweithöchsten nach „offen“. Der Atlas der Zivilgesellschaft stützt sich auf Bewertungen des weltweiten Netzwerks CIVICUS, das die Freiheitsrechte in fünf Kategorien von „offen“ bis „geschlossen“ einstuft.
Zusätzliche Angebote der Gedenkstätte Museum in der "Runden Ecke" zum Leipziger Stadtfest und zum Wave-Gotik-Treffen vom 6. bis 9. Juni 2025
5.06.2025
(Leipzig/re) - Leipzig als Stadt der Friedlichen Revolution – unter diesem Blickwinkel will die Gedenkstätte Museum in der „Runden Ecke“ sowohl den Gästen des Stadtfestes als auch und vor allem den Besuchern des Wave Gotik-Treffens (GTW) die Stadt vorstellen. Von Leipzig gingen 1989 wichtige Impulse für den demokratischen Aufbruch im ganzen Land aus. Zu den historischen Schauplätzen gehört die „Runde Ecke“, die ehemalige Bezirksverwaltung für Staatssicherheit, direkt am Leipziger Innenstadtring gelegen, auf dem vor über 35 Jahren die Montagsdemonstrationen stattfanden. Heute befindet sich in den originalen Räumen eine Gedenkstätte. Anlässlich der Feste lädt diese zum Besuch der Ausstellungen und zu zusätzlichen Rundgängen und Führungen ein.
Lange Museumsabende, Sonderführungen sowie Stadt- und Geländerundgänge
Ab Freitag, 6.Juni – bietet die Gedenkstätte verlängerte Öffnungszeiten sowie zahlreiche Sonderführungen an. Zu sehen sind die historische Ausstellung Stasi – Macht und Banalität“ sowie die Sonderausstellung „Die Kehrseite der Medaille. Sport in der DDR – (Körper)Erziehung im Dienst der SED“, die Kabinettausstellung „Zweimal befreit? Leipzig unter amerikanischer und sowjetischer Besatzung 1945“ und die Ausstellung „Die Friedliche Revolution in Leipzig“. Rund um die Uhr kann die Open-Air-Ausstellung „Von der Burg zur Stasi-Zentrale. Erinnerungen an den Leipziger Matthäikirchhof“ besucht werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.runde-ecke-leipzig.de.
Zu den Ausstellungen der Gedenkstätte Museum in der „Runden Ecke“
Die Ausstellungen haben am Pfingstwochenende vom 6. bis 9. Juni 2025 verlängerte Öffnungszeiten täglich von 11.00 bis 20.00 Uhr. Die Open-Air-Ausstellung ist rund um die Uhr zugänglich.
Die historische Ausstellung „Stasi - Macht und Banalität“
dokumentiert Geschichte, Struktur und Arbeitsweise des Ministeriums für Staatssicherheit. Wanzen, konspirative Fototechnik, Geräte zum Öffnen von Post, eine Maskierungswerkstatt - mit zahlreichen einzigartigen Exponaten dokumentiert Ein Rundgang durch die Gedenkstätte soll bewusst machen, wie wertvoll Freiheit und Demokratie sind - nicht zuletzt als Grundlage für faire sportliche Wettkämpfe. Gleichzeitig ist die „Runde Ecke“ ein Symbol für die friedliche Selbstbefreiung von der SED-Diktatur.
Für diese Ausstellung steht ein Audioguide in 8 Sprachen (deutsch, englisch, französisch, spanisch, niederländisch, arabisch, italienisch und polnisch) zur Verfügung
Die Ausstellung „Die Friedliche Revolution in Leipzig“
zeigt anschaulich, dass für die Überwindung der SED-Diktatur wesentliche Impulse von Leipzig ausgingen. Der gewaltfreie Demonstrationszug von weit mehr als 70.000 Menschen auf dem Leipziger Innstadtring am 9. Oktober 1989 wurde als Entscheidung für eine Friedliche Revolution und als Sieg über das SED-Regime empfunden. Die Ausstellung im ehemaligen Stasi-Kinosaal informiert über das Wirken der Leipziger Opposition, die bereits seit Beginn der 1980er Jahre vor allem aus dem kirchlichen Umfeld heraus kontroverse Themen anzusprechen wagte. Die Aktionen des politischen Widerstandes in Leipzig sowie die Ereignisse, die zur Friedlichen Revolution und zur Neugründung des Freistaates Sachsen sowie zur Deutschen Einheit im zusammenwachsenden Europa führten, werden nachgezeichnet. Auch wird ein Blick auf unsere ost-mitteldeutschen Nachbarn und deren Engagement für Freiheit und Demokratie geworfen.
Die Ausstellung „Die Kehrseite der Medaille“
zeigt, wie der Sport in der DDR zum politischen Instrument wurde: Glanzvolle Turnfeste, ein breites Angebot im Freizeitsport, zahlreiche Olympiasiege - das war die Schauseite der Medaille. Die Kehrseite: ideologische Überfrachtung, Militarisierung, staatliche Dopingprogramme. Sport sollten die Bürger der DDR nicht nur im Dienst ihrer eigenen Gesundheit, sondern immer auch im Dienst der SED treiben. Wenn Kinder sich im Schulsport auf ihre Aufgaben bei der Landesverteidigung vorbereiteten, wenn zum Turnfest auf der Osttribüne des Zentralstadions die Losung „Dank dir Partei“ erschien, wenn Tausende MfS-Mitarbeiter – hauptamtliche und inoffizielle (IM) – zur Absicherung der Turn- und Sportfeste abgestellt wurden, dann ging es vor allem um zwei Dinge: Ein ganzes Volk in ständiger Wehrbereitschaft zu halten und durch sportliche Höchstleistungen die Überlegenheit des Sozialismus zu demonstrieren.
Die Ausstellung „Zwei Mal befreit? Leipzig unter amerikanischer und sowjetischer Besatzung 1945“
präsentiert Forschungsergebnisse mit einzigartigen und teilweise bisher unbekannten Fotos, Filmaufnahmen und Dokumenten: Am Abend des 18. April 1945 erreichten amerikanische Truppen Leipzig und befreiten die Stadt von der nationalsozialistischen Terrorherrschaft. Sie richteten in der „Runden Ecke“ ihr Hauptquartier sowie kurzzeitig die Alliierte Militärregierung ein, die einen demokratischen Neuanfang veranlasste. Durch die Übergabe Leipzigs an die Rote Armee am 2. Juli 1945 fand der demokratische Neuanfang ein jedoch jähes Ende. Damit begann für die Stadt Leipzig der Weg in eine neue Diktatur.
Die Open-Air-Ausstellung „Von der Burg zur Stasi-Zentrale. Erinnerungen an den Leipziger Matthäikirchhof“
wird im Rahmen der Diskussion um die Zukunft des Areals der ehemaligen Stasi-Bezirksverwaltung auf dem früheren Matthäikirchhof von der Gedenkstätte präsentiert. Auf dem Hintergrund der mehr als 1000-jährigen Stadtgeschichte Leipzigs, die hier mit der „urbe libzi“ ihren Ursprung nahm, steht vor allem die Entwicklung seit Anfang des letzten Jahrhunderts im Mittelpunkt. Vom Verwaltungsneubau der Leipziger Feuerversicherungsanstalt 1913, über die Zerstörung der Matthäikirche und des gesamten angrenzenden Areals in der Bombennacht vom 4. Dezember 1943, der Nutzung der „Runden Ecke” nach dem Ende der NS-Diktatur unter amerikanischer und sowjetischer Besatzung sowie schließlich als Sitz der Bezirksverwaltung des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) bis zur Besetzung während der Friedlichen Revolution am 4. Dezember 1989 und der nachfolgenden Auflösung wird die wechselvolle Geschichte dieses Areals bis in die Gegenwart erzählt.
Ort: Goerdelerring, ehemaliger Stasi-Neubau / in Nähe Klingertreppe
Zu den Sonderführungen sowie Stadt- und Geländerundgängen
Während des Stadtfestes, zum Pfingstfest und zum Wave-Gotik-Treffen (WGT) bietet die Gedenkstätte Museum in der „Runden Ecke“ eine Reihe zusätzlicher Termine für Sonderführungen sowie Stadt- und Geländerundgängen an.
Der Geländerundgang „Stasi Intern“
vermittelt den Besuchern das gewaltige Ausmaß des einst einschüchternden Ortes der Diktatur. Dabei können Besucher sonst nicht öffentlich zugängliche Räume – abseits der Ausstellungsräume – sehen und die Dimension des Gebäudes und die historischen Ereignisse am Ort besser miteinander verknüpfen. Bei dem Rundgang wird auch über die mögliche Entwicklung des Areals gesprochen, das zu einem „Forum für Freiheit und Bürgerrechte“ weiterentwickelt werden soll.
Vom Keller bis zum Boden können u.a. die verbunkerten Schutzräume für den Kriegsfall im zweiten Kellergeschoss, der Wartebereich der Stasi-eigenen Poliklinik oder die Kegelbahn des MfS besichtigt werden. Auch Überreste der Aktenvernichtung sind zu entdecken.
Treffpunkt: Gedenkstätte Museum in der „Runden Ecke“ (Eingangsbereich)
Termine: Samstag, 7. Juni 2025 um 16.00 Uhr
Sonntag, 8. Mai 2025 um 17.00 Uhr
Der Stadtrundgang „Auf den Spuren der Friedlichen Revolution“
führt zu den Ereignissen der Friedlichen Revolution in Leipzig. Herbst ´89: Die Bilder von den Friedensgebeten in der Nikolaikirche, den Montagsdemonstrationen auf dem Innenstadtring und der Besetzung der Leipziger Stasi-Zentrale gingen um die Welt. Die Chronik des Herbstes ´89 begann in Leipzig aber nicht erst mit den Demonstrationen im September und Oktober. Der geführte Stadtrundgang erinnert an markanten Punkten der Leipziger Innenstadt an die historische Entwicklung des Jahres 1989. Zeitgeschichte wird am Ort des Geschehens lebendig und nachvollziehbar.
Treffpunkt: Hauptportal Nikolaikirche
Termin: Samstag, 7. Juni 2025 um 14.00 Uhr
Sonntag, 8. Juni 2025 um 11.00 Uhr
Führung „Von der Stasirepression zur Deutschen Einheit“
Eine kombinierte Führung durch die Ausstellungen „Stasi – Macht und Banalität“ und „Die Friedliche Revolution in Leipzig“ im 35. Jahr der Deutschen Wiedervereinigung
Treffpunkt: Gedenkstätte Museum in der „Runden Ecke“ (Eingangsbereich)
Termine: Freitag, 6. Juni 2025 um 16.00 Uhr
Montag, 9. Juni 2025 um 11.30 Uhr
Rundgang zu den „Orten der Friedlichen Revolution“ mit der App „Leipzig `89“
Außerdem zu finden ist die Open-Air-Ausstellung „Orte der Friedlichen Revolution“ mit 20 Informationsstelen im Stadtraum, die mit der App „Leipzig ‘89“, welche auch als Audioguide fungiert, mehrsprachig erkundet werden kann.
Der digitale Stadtrundgang verdeutlicht die Besonderheit, Vielschichtigkeit und Einmaligkeit des Gesamtereignisses Friedliche Revolution in Leipzig. Interessenten können sich nicht nur über die bekanntesten Ereignisse wie die entscheidende Montagsdemonstration am 9. Oktober 1989, die Besetzung der Stasizentrale am 4. Dezember 1989 oder die ersten freien Volkskammerwahlen am 18. März 1990 informieren. Auch an kleinere, aber deshalb nicht unbedeutendere Aktionen öffentlichen Protestes gegen die SED-Diktatur wird erinnert.
Der Rundgang macht die zeitliche und räumliche Entwicklung der Friedlichen Revolution erlebbar und anhand der historischen Fotos gleichzeitig den Stadtwandel seit 1989 nachvollziehbar. Er erinnert an die Kraft der demokratischen Idee, die den Bürgern zur Selbstbefreiung von der SED-Diktatur verhalf. Die App „Leipzig ´89“ präsentiert ein wichtiges Kapitel der deutschen Demokratiegeschichte sowie die besondere Rolle Leipzigs als Stadt der Friedlichen Revolution eindrucksvoll.
Die App „Leipzig‘89“ ist eine moderne Ergänzung der Angebote der Gedenkstätte Museum in der „Runden Ecke“, insbesondere der Open-Air-Ausstellung „Orte der Friedlichen Revolution“ und der Ausstellung „Leipzig auf dem Weg zur Friedlichen Revolution“ im ehemaligen Stasi-Kinosaal.
Den Link zu den App-Stores findet sich unter www.runde-ecke-leipzig.de/index.php?id=649

